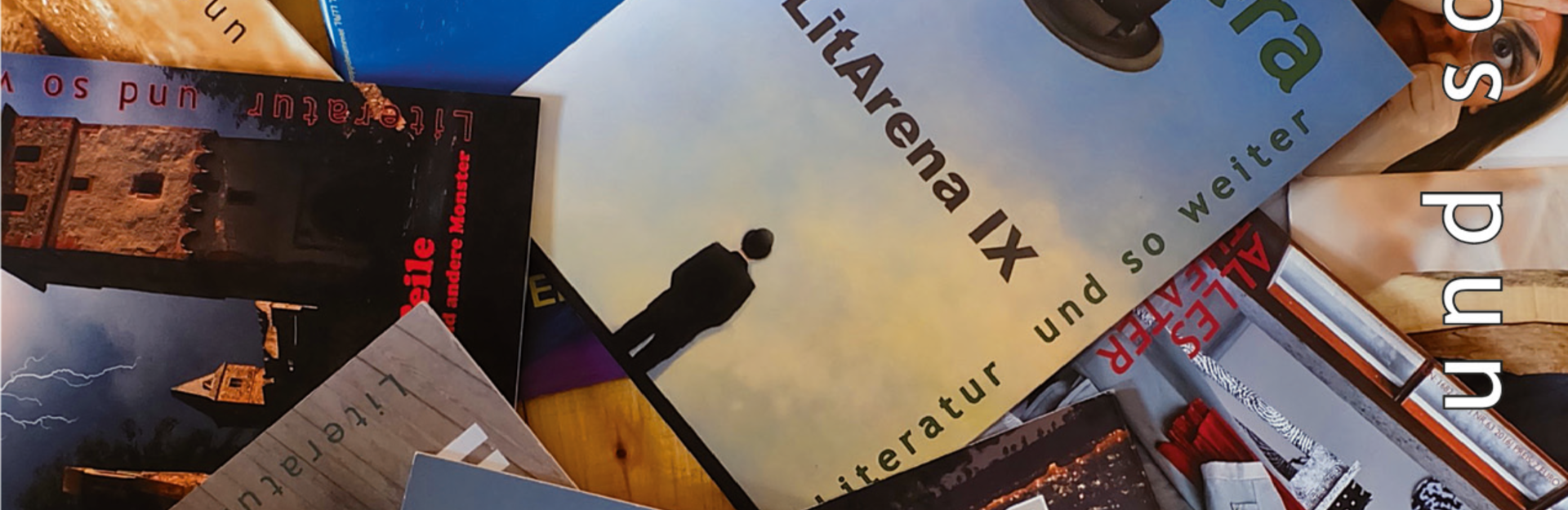50/Wozu Literatur?/Essay: Wozu Literatur? Wolfgang Mayer-König
Wolfgang Mayer-König
Wozu Literatur?
Wäre da nicht das Fragezeichen, stünde auch schon das Bezweifeln allen Nutzens von Literatur im Raum. Sei es nun wegen irgendwelcher bis zur Genüge erlebter Enttäuschungen im Umgang mit Literatur oder aber in Folge diffuser Voreingenommenheit gegenüber dem literarischen Wirken. Trotz dieser scheinbaren Polarisierung des Zweifels am Nutzen der Literatur scheinen sich dennoch die Beurteilungsansätze sowohl der Autoren als auch der Konsumenten von Literatur spürbar anzunähern. Beiden geht es so ganz und gar nicht leicht von der Hand, die Erfahrung und das Urteil in eine Fragestellung umzugießen, um quasi einen letzten Fluchtweg wenigstens ins Ungewisse aufzutun. Die Frage nach dem Nutzen der Literatur scheint jedenfalls abgedroschen zu sein, sie besitzt zumindest einen schalen Nachgeschmack. Trotz alledem steht außer Zweifel, dass politische und historische Geschehnisse, so wie deren wichtige und etwas weniger wichtige Protagonisten der letzten Jahrhunderte der menschlichen Entwicklungsgeschichte weit weniger bis auf den heutigen Tag im Bewusstsein der Leute verankert scheinen, dorthin hinübergerettet werden konnten und selbst dem Interessierten, ja dem Bildungsbürger so präsent sind, wie wesentliche Werke der Literatur und Namen bekannter Autoren. Wer weiß schon, wer aller die letzten einhundertfünfzig Jahre Mitglied einer österreichischen Regierung war? Die Autoren dieser Zeit wie Kafka, Schnitzler, Musil, Rilke, Doderer, Ödön von Horwath, Hoffmannsthal etc. kennt man allemal.
Diese Geltung ließe sich lückenlos ebenso auf die deutsche, französische, russische, englische, amerikanische Literatur, ja auf die Literaturen aller sogenannten Kulturnationen dieser Welt übertragen. Also muss Literatur doch einen Nutzen haben. Dies liegt logisch auf der Hand. Alles fachspezifische Koordinieren des Zusammenlebens der Menschen geht trotz dessen Archivierens, dessen Katalogisierens und dessen Kanonisierens den Weg allen Vergessens, den Weg allen Kehrichts. Niemand braucht und will sich an die Mühen des ständigen Auf und Ab, des seelischen, ökonomischen und rechtlichen Zerriebenwerdens des in seine gesellschaftliche Umwelt hineingeworfenen Menschen mehr erinnern. Über ihn ist, ob gerecht oder ungerecht, juristisch abgesprochen worden. Es bleiben die Beurteilungen nach dem jeweiligen Gutdünken des Zeitgeschmacks als nutzlose, unbedeutende verbale Strukturen über. Die fleischgewordene seelische Qual, die Augenblicke der Todesangst aber auch der Freude und des Glücks sind verflossen, verhallt, haben sich in Nichts aufgelöst. Vielleicht liegt das an der Vergänglichkeit des ewig geglaubten Büros, an der eigentlichen Unverwaltbarkeit menschlicher Bedürfnisse, daran dass die Geschichte nie wirklich für den Menschen selbst eingetreten ist, sondern ihn vielmehr zum sozialen Quotienten degradiert hat. Wenn auch Politik dem Spezialistentum durch sachübergreifendes Herumspringen von einem Gedankengut zum anderen zu entfliehen trachtet, so liegt darin nur einer von vielen Gründen ihres Versagens. Literatur schafft das viel mehr, weil sie laufend nach der ethisch und ästhetisch stimmigen Wirksamkeit jeder Aussage, jeder Schaffensphase, Rückschau halten und überprüfen muss, ob ein Satz gegenüber dem Vorsatz und dem Folgesatz noch stimmig ist oder aber die Verweisungsfunktion verloren hat. Die Vorgänge, die wir täglich erleben, sind zwar nicht in einem literarischen Text eins zu eins unterzubringen, weil wir selbst im wahrsten Sinne des Wortes nicht „hineingehen“. Wie sonst schafft es dann Literatur, die Dramatik der uns tagtäglich vor Augen geführten Ereignisse und ihre sich oft überschneidenden Entwicklungen zu verarbeiten? Literatur ist ja nicht Produkt logischen Denkens, sondern die Äußerung eines Menschen auf der Suche nach dem Sinn oder Witz des Lebens, der die Ereignisse seiner Umwelt in Sprache umsetzt und gestaltet.
Dieses Umsetzen geschieht aber in einer anderen Art, zur Sache zu kommen. Jedenfalls nicht in der herkömmlichen Art, Fragen zu beantworten, sondern es wird der Versuch unternommen, sich anhaltend selbst zum Gegenstand der Fragestellung zu machen. So lange, bis das Erlebte greifbar nahe gebracht, fassbar und anfassbar wird, so dass wir davon reden können, es „begriffen“ zu haben. So, dass das Erlebte als Gestalt mit eigener Persönlichkeit am Ende dieses Weges steht. Die Probleme werden nicht verdrängt, sonst käme ja keine Literatur zu Stande. Der Leser kann sich dadurch über den eigenen Standort mehr Klarheit verschaffen, über das Wachstum seines Bewusstmachens, Bewusstwerdens und Bewusstseins, seines eigenen Begreifens, Erfahrens, Fassens und Anfassens. Nur so wird er auch seiner eigenen Urteilskraft gegenüber Zuverlässigkeit empfinden können. In der Literatur geht es darum, sich einem Thema ethisch und ästhetisch seriös zu nähern. Literatur soll nicht überreden, sondern überzeugen. Sie macht es also zur Voraussetzung, dass der Literaturbetrieb und die ihm innewohnende Plumpheit rechtzeitig in den Hintergrund treten (natürlich auch die Literaturwissenschaft), um sich beizeiten selbst immer wieder aufzuzehren. Denn entscheidend muss ja das literarische Werk selbst sein und nicht die Emballage. Literatur besitzt in einer Welt von Spezialistentum und Arbeitsteilung eine Dimension, die keine andere Äußerung mit ihr gemeinsam hat, nämlich die Fähigkeit zur Zusammenschau gänzlich verschiedener Dinge.
Wozu Literatur? Deshalb!
Gute Literatur ist aus Konkretem gemacht, das die verschiedenen Verstehensrichtungen wirksam erhält. Deshalb zählt es auch zum Risiko der Literatur, nicht so zu sein, wie es der Leser von ihr erwartet. Oder auf hoffnungslosem Terrain zu stehen und auf etwas zu warten, was wahrscheinlich niemals kommen wird, sich wahrscheinlich niemals einstellen wird.
Literatur darf sich trotz alledem nicht in ihrer Anpassungsfähigkeit gefallen. Auch hat Literatur das triviale menschliche Risiko, besonders dann, wenn Menschen klar wird, dass sie immer ungelegen kommen oder wenn sie die Hoffnung auf Gerechtigkeit aufgegeben haben. Dass Menschen es verdient haben, verstanden zu werden, muss insbesondere für die Literatur Gültigkeit haben.
Sich um ein immer ernsthafteres Verständnis der Wesen zu bemühen, das ist der Zweck der Literatur. Die Entfremdung gegenüber diesem Zweck schafft sich ihre eigenen Dichter. Die in selbstbiografischer Romantik verstrickten Leider. Sie sind geradezu ungeeignet, Brücken zu schlagen, noch dazu in uferlosem Terrain. Sie schaffen es mühelos, den politischen Schwachsinn zu kritisieren, um sich gleichzeitig von ihm fördern und behüten zu lassen. Es wäre kein Emile Zola gewesen, wenn er sich nicht so für Dreyfuss bis zur Erschöpfung gegen alle Widernisse selbstlos eingesetzt hätte. Daraus geht große Literatur hervor, wie die eines Hugo, Balzac, Zola und Dostojewski. Wie groß sind und waren die Risiken derer, die sich der Herstellung von Verständnis verschrieben haben.
Ich meine hier natürlich nicht nur das existentielle Risiko des Schriftstellers, obwohl dieses im Vergleich zu vielen anderen Berufen von einer nicht zu unterschätzenden Härte ist. Sondern auch das Risiko, anders zu schreiben und schreiben zu müssen, als es erwartet wird. Oder zu schreiben, ohne Hoffnung auf ein interessiertes Gegenüber. Kaum eine Berufsgruppe muss mit einem solchen psychischen Druck existieren. Und gerade deshalb Literatur! Nicht von ungefähr ist dichte und gestaltende Sprache oft dort zu finden, wo die Menschen keinen Reiz und Nutzen verspüren, zu verweilen. Der Mensch hat nun einmal auf Grund seiner mangelnden Bewältigungskraft den Hang zur Idealisierung, zur Abrundung und zum Happy End. Und obschon er sich zeitweilig auch gerne das Fürchten lernen möchte, steht er dann fassungslos vor Entwicklungen, deren er nicht Herr wird. Gleichzeitig hat er auch schon mit dem sinnlosen Ende zu leben gelernt. Er setzt bewusst auf die Wiedergabe seiner Ängste, ohne Aussicht auf irgendwelche trügerischen Hoffnungen. Deshalb Literatur, weil es nichts anderes ist, als Ängste und Hoffnungen der Menschen und nicht, wie viele Glauben, zuvorderst lediglich Fantasie und Theaterdonner. Nein, Literatur, das sind Seelenvorgänge um Verständnis ringender Menschen. So wirklich, wie Ängste, Hoffnungen und Enttäuschungen nur sein können. Deshalb müssen sie ausgesandt werden. Deshalb können das Wort und die Form nicht ersetzt werden durch anderes. Deshalb braucht es die Literatur!
Der Fehlbetrag an Leben kann durch nichts ausgeglichen werden. Es misslänge ohne Literatur auch, etwas oder jemanden zu begreifen. Weil die Wirklichkeiten durch die Analogien ihrer sprachlichen Symbole begründet und die Ähnlichkeiten der Geschichten und ihrer Schreibweisen dadurch genützt werden, dass die Gebärden der handelnden Personen, ihre Ideen und Schicksale nur mit einem ethisch und ästhetisch treffenden Zeichen versehen werden müssen, um ihnen ihre vollkommenere Spiegelung zu ermöglichen.
Wolfgang Mayer König
Geb.1946, lebt als Schriftsteller und Universitätsprofessor in Niederösterreich und Graz. Bisher 33 Buchpublikationen im In-und Ausland. Gründer des Universitätsliteraturforums “Literarische Situation”. Herausgeber der Literaturzeitschrift “LOG”, in welcher bislang 1350 Autoren aus 146 Nationen erstveröffentlicht wurden. Koordinator der Int. humanit. Wiederaufbauhilfe für Vietnam. Verfasser des Zivildienst-Bundesgesetzesentwurfs. Ehrenobmann der Literarischen Gesellschaft St. Pölten. Österr. Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse, Chevalier des Arts et des Lettres de la République Française, Internationaler Friedenspreis, Großes Ehrenzeichen von Steiermark und Kärnten, Goldenes Ehrenzeichen des Landes Wien.
LitGes, etcetera Nr 50/ Wozu Literatur?/ November 2012