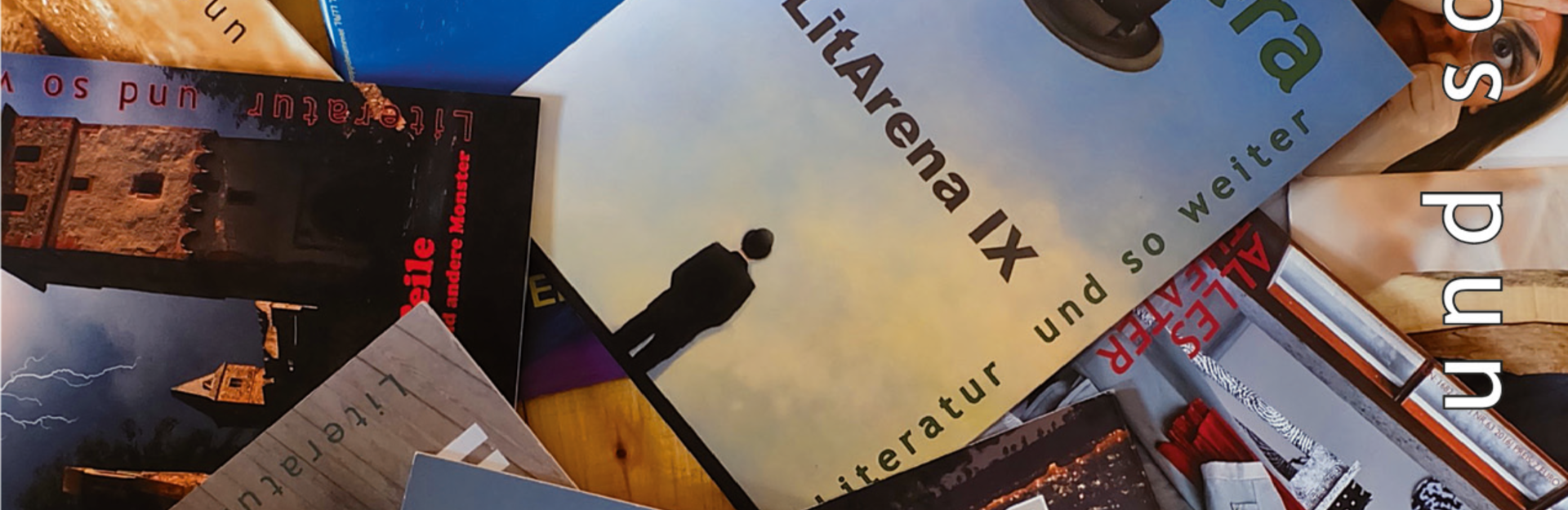Ein Nachruf: Die Schwelle, Wolfgang Mayer König
Ein Nachruf
DIE SCHWELLE
Eine Erzählung der letzten Dinge
Wolfgang Mayer König
Es sind Gesten und Veränderungen in der Stimmlage eines Menschen, die man so schnell nicht vergisst, weil sie höchst unerwartet und einprägsam hervortreten. Ihre Stimme und die sie begleitenden Gesten wurden zum Ende hin immer sanfter. Es war, als ob sie zur stillen Wächterin jener Schwelle geworden sei, die zwischen Leben und Leben liegt. Ihr ging es nicht wie den meisten anderen Menschen vor allem darum, die eigene Leibmaschine bestmöglich in Schwung zu halten. Für sie war, was ihr letztlich zum Verhängnis wurde, körperliches Unwohlsein noch lange nicht Grund genug dafür, sogleich den Arzt aufzusuchen und sich gegen alles und jedes Medikamente verschreiben zu lassen.
Sie war im Gegenteil beharrlich auf ein ganz anderes Heil bedacht, was es ihrer unmittelbaren Umgebung nicht immer leicht machte, sie zu verstehen. Sie lebte dadurch in einem ständigen Zwiespalt: Sie misstraute allen vordergründigen Wirklichkeiten und jenen äußeren Verhältnissen, die den Menschen animieren, sich mit nebensächlichen, abstumpfenden Dingen abzugeben, die nur deshalb vordergründig sind und sich anbieten, weil die Standards des Lebens sie beachtlich machen und ungebührlich hervorheben. Sie fühlte sich und ihre Mitmenschen einer ständigen Vergiftungsgefahr durch diese allzu wohlfeilen Wirklichkeiten ausgesetzt. Obwohl sie gleichzeitig eine praktisch veranlagte Frau war, die drei Söhnen das Leben geschenkt und sie an der Seite ihres Mannes zu tüchtigen Männern großgezogen hat. Sie hat damit auch bewiesen, dass es nicht selbstverständlich zum Metier des Schriftstellers gehört, einzelgängerisch und selbstbezogen fortwährend nur um die eigene Selbstverwirklichung bekümmert zu sein, sondern dass die Gründung einer Familie und die mit aller Selbstverständlichkeit ausgeübten hausfraulichen Obliegenheiten in keinerlei Widerspruch zur schriftstellerischen Attitüde stehen müssen.
Trotzdem misstraute sie den vordergründigen Dingen. Sie entwickelte im selben Maße einen unbeirrbaren Glauben an all das, was hinter den Dingen steht und was sie mit dem verband, was von einem Raum des Lebens über die Schwelle, die sie deshalb mit aller Konsequenz behüten wollte, in einen anderen Raum führt, der die Dinge, auf die es ankommt, in einem wahrhafteren Licht zeigt.
Am untrüglichsten zeigte sich dies an ihrer Sprache. Weiß Gott, sie wusste, wie man spricht und schreibt, hat zahlreiche Werke verfasst, kraftvolle Inhalte und Figuren geformt und in ihrer Literatur sprachliche Neuschöpfungen und besonders einprägsame Wendungen entwickelt. Ihre Texte sind modern und so aktuell, dass man sich gar nicht näher dem Puls der Zeit zu nähern vermag. Im selben Atemzug verwendete sie im Umgang mit Menschen jedoch die einfachst mögliche und verständlichste Sprache, weil sie mit dem Sprechen stets auch die Segnung des Angesprochenen verband. Denn dort lag ja der Bezug auf all das, dem sie bedingungslos vertraute. Stets freundlich nahm sie Nachrichten entgegen und richtete solche aus, nicht ohne dabei mit der ihr eigenen Würde und ihrem besonderen Respekt vor anderen Menschen hinzuzufügen: „Auf all deinen Wegen möge dich Gott behüten, die Gottesmutter möge dich und die deinen immer beschützen.“ Dabei entwickelte die sonst keineswegs neugierige Frau ein besonderes Interesse für das Wohlergehen auch der Angehörigen ihres Gegenübers, weil sie aus eigener Erfahrung wusste, dass persönliches Glück in familiärem Zusammenhalt besser gedeihe als in Einsamkeit. So blieben ihre Glück- und Segenswünsche niemals eine bloße Leerformel, sondern waren stets eine kraftvolle Beschwörung eines gütigen, barmherzigen Geschicks.
Mit der selben Konsequenz, mit der sie die toxischen Auswirkungen der vordergründigen Wirklichkeiten bekämpfte, vertraute sie sich beispielsweise der nur scheinbaren Machtlosigkeit jener Mutter an, die wie sie einst ihr Söhnchen liebkosend an die Wange hielt. Sie war fest davon überzeugt, dass die Ohnmacht dieser liebevollen Einheit aus Mutter und Sohn, unter dessen Kreuz diese Mutter später stehen sollte, täusche. Sie war felsenfest davon überzeugt, dass das Kind im Einklang mit seiner Mutter die tatsächliche Weisheit des Lebens sei, zwar der Zeit unterworfen, aber dennoch Ursprung und Ende aller Tage. Das waren die Wirklichkeiten, für die sie lebte und starb, und deren räumlichen Übergang, ob man sie dabei ernst nahm oder nicht, sie wie eine stille Hüterin der Schwelle deshalb konsequent beschützte. Es war also nur eine logische Folge, dass sie in den täglichen Begegnungen an dieser Spaltung zwar immer öfter scheitern musste, sie hat sich aber darüber nie beklagt -und stets waren es auch die ihren, die sie von ihren Flügen ins Nirgendwo und ihren Fahrten, die sie auf einsame Bahnhöfe des Lebens führten, wieder in den Schoß der Familie zurückführten, die sie selbst so vorbildlich aufgebaut hatte.
Der Umstand, dass sie sich immer mehr in sich zurückzog und, obwohl erst einundsiebzigjährig, kaum mehr das Haus verließ, führte dazu, dass sich in einem der Vorhöfe ihres Herzens ein Plaque löste, ein kleiner Trombus bildete, der ihrem Leben ein Ende bereitete. Als sie mit ihrem Kopf ermüdet auf dem Küchentisch zum letzten Mal einnickte und alle Wiederbelebungsversuche fehlschlugen, jährte sich gerade der Tag zum vierzigsten Mal, als sie einst als junge Schriftstellerin Südosteuropa verließ und in eine ungewisse Zukunft, ein anderes kulturelles Milieu nach Niederösterreich aufbrach. Niemand wusste besser als sie, wie denen zu Mute ist, deren größtes existentielles und literarisches Problem darin liegt, nicht autochthon leben zu können. Sie war ja eine echte Dissidentin und konnte später in anhaltender Weise jene Anliegen aufzeigen, die Autoren aus Südosteuropa in Untergrund und Verbannung durchgekämpft und so an vordester Front jene Entwicklungen herbeigeführt haben, die sie mit Freiheit für Südosteuropa verbunden wissen wollten - ohne jedes Schielen nach späterem Vorteil, ohne jedes Spekulantentum. Das heißt auch den Entwicklungen nicht im Nachhinein zu begegnen, sondern sich rechtzeitig zu exponieren, was sie, weiß Gott, getan hat. Allerdings auch in dieser Hinsicht unterlag sie der für sie typischen Spaltung. Als nämlich die alten systemimmanenten Funktionäre, die um eine lückenlose Verhinderung persönlicher Freiheit kulturellen Schaffens stets so bekümmert waren, vor und nach der Wende wieder hinauf schwammen – teilweise sogar in die alten Ämter - und mit heuchelnder Umsicht ihre Schergendienste fortsetzen wollten, war sie nicht bereit, jeden menschlichen Kontakt zu meiden und solchen Menschen einfach aus dem Weg zu gehen. Sondern es galt für sie ausnahmslos das Prinzip am Leben zu erhalten, dass auch der ärgste Missetäter immer noch ein einer Begegnung würdiger Mensch sei. Ihr entschlossener Kampf in Wort und Tat galt ja dem Menschenrecht und der Menschenwürde, die sie viel mehr mit den Bedürfnissen des Menschen selbst verknüpft wissen wollte und nicht mit den Bedürfnissen jener, die im eigenen Interesse nur auf die Arterhaltung der Systeme bedacht waren. Aber auch sie, wo immer sie standen, blieben für diese Frau immer noch Menschen, so dass diese ihre Haltung mit dem Zynismus der Umschwungsgewinnler geradezu als Beweis für eine naive Gutmütigkeit hingestellt werden konnte, die man unschwer zu übertölpeln hoffte.
Viele, die weit weniger Gültiges hervorbrachten, haben Mittel und Wege gefunden, sich als Staatsdichter da und dort küren zu lassen. Das alles war nicht ihr Weg und ihre Sache. Sie selbst war zu Lebzeiten herzlich wenig um eigenen Nachruhm bemüht. Sie war eine der wenigen, die sich nicht schon den eigenen Nachruf selbst verfasste. Nein! Ganz im Gegenteil! Sie hatte besseres zu tun; sie war nämlich um das Werk der anderen bemüht. Sie war ständig damit beschäftigt, sich für die Werke anderer einzusetzen, weil sie das Brackwasser der immerfort selbstbezogenen Wiedergabe der Autoren immer tüchtig aufrühren und mit Frischwasser beleben wollte. Und auch hier begegnen wir der für sie typischen Spaltung. Texten, die von allen Redaktionen abgelehnt wurden und für die sich nirgendwo eine Resonanz abzeichnete, wollte sie eine Chance geben und bedrängte Freunde, diesen Autoren eine Möglichkeit zu bieten, wenn die Qualität deren Literatur auch nur ansatzweise vorhanden war. Sie hielt stets daran fest, dass nur der sich entwickelnde Autor, der einen Widerhall deshalb spürt, weil seine, wenn auch nur kleinen Ansätze des Könnens nicht verworfen sondern erkannt werden, auch weiterhin einen gemeinschaftlichen Sinn darin erkennen wird, an seiner Sprache und seinen Inhalten weiter zu arbeiten, und Schritt für Schritt Grenzen -ob menschlich oder weltanschaulich - zu überwinden. Gleichzeitig trat sie unbeirrbar gegen die fruchtlosen Eitelkeiten und Hohlheiten des Literaturbetriebs auf und machte dabei vor ihrer unmittelbaren Umgebung nicht Halt. Oft stellte sie in Aussicht, alle unnotwendigen Unterlagen, die nur der Eitelkeit und Selbstherrlichkeit von Autoren auf Kosten anderer dienten, dem Papierkorb übergeben zu wollen, weil sie dort hingehörten und mit allfälliger Kreativität doch nicht das geringste zu tun hätten. Das hat vielen, zugegebenermaßen, eine Zeitlang einiges Kopfzerbrechen bereitet. Sie behielt aber auch hier recht. Nur mit dieser Einstellung konnte man sich grundsätzlich aus vielen Intrigen heraus halten, ohne in ihren Strudel zu geraten. Ihre scheinbar verrückte aber im Grunde nur konsequente Haltung als Schriftstellerin und als Förderin aufkeimender Literatur konnte so nicht nur begünstigen, sondern auch vor etlicher Unbill bewahren.
Ihre, wie mir jetzt scheint, allerdings hervorragendste Eigenschaft war ihre hingebungsvolle Hilfsbereitschaft für das unüberprüfte Leid der anderen. Wie oft hat sie mich noch spät abends angerufen und mir mit Nachdruck vor Augen geführt, dass es diesem oder jenem Autor oder Nichtautor gar nicht gut gehe und ihm dringend zu helfen sei. Dabei erklärte sie vorsorglich zu diesen Ersuchen, die sie geradezu bis zur Selbstverleugnung vortrug, dass ihr bewusst sei, dass jede Hilfe für unüberprüftes Leid die Gefahr mangelnder Treffsicherheit mit sich brächte, und dass dadurch sehr oft auch Unverdiente, Verschwender und ewig Unbelehrbare an Stelle von wirklich Bedürftigen in solchen Genuss kämen. Aber das Leid könne nie wirklich geprüft werden, wer wisse schon, wie tiefgreifend und schwer es sich entwickle. Also lieber einmal zu viel als zu wenig helfen.
Aus all dem ergibt sich, dass diese Frau für ihre Umwelt nicht immer leicht zu verstehen und auch nicht immer berechenbar war; auch für die Jugend, deren Überlebenskampf und Selbsterhaltungstrieb sich naturgemäß an den sogenannten Wirklichkeiten des Lebens orientieren muss, war sie nicht immer leicht zu verstehen. Die stete Spaltung, die sie so immer mit sich trug, erwuchs ihr ja eben aus den sich scheidenden Wegen, die von einem Raum des Lebens in den Raum des von ihr bevorzugten Leben führten. Weil sie es als das wahrhaftere, das weiterführendere erkannt hat. Sie bewacht die Schwelle zwischen diesen beiden Räumen nicht mehr für uns sichtbar. Sie hat ihren diesseitigen Platz verlassen. Er ist leer. Wir fühlen und begreifen erst jetzt, dass kaum jemand dem Übertritt in diesen jenseitigen Lebensraum so vorbereitet nahe stand wie sie. Weil sie für das eintrat und für das stand, was andere vielleicht nicht so sehen konnten oder wollten, woran sie aber von Anbeginn an mit allem Glauben, ja sogar wissentlich festhielt.
Zum Autor:
Wolfgang Mayer König, geb. am 28.3.1946 lebt als Universitätsprofessor und Schriftsteller in Niederösterreich. Er ist Autor zahlreicher in mehrere Sprachen übersetzter Bücher und Herausgeber der Zeitschrift für internationale Literatur LOG, in welcher bislang über tausend Autoren aus über hundert Nationen erstveröffentlicht werden konnten. Begründer des Universitätsliteraturforums „Literarische Situation“. Theodor Körner Preis, Plato Award, Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I.Klasse, Chevalier des Arts et des Lettres de la Republique Française.