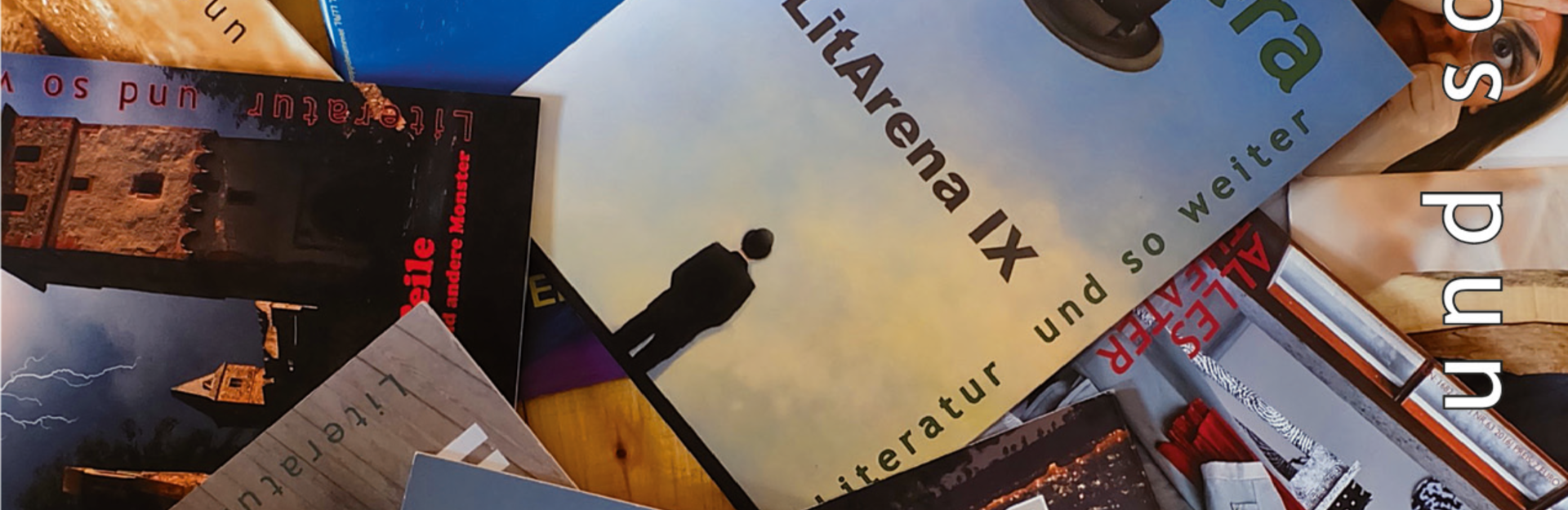60/Unentwegt/Interview: Ursula Krechel
Ursula Krechel
Stark und leise
Die in Berlin lebende Autorin Ursula Krechel recherchiert un.ermüdlich die Schicksale von Vertriebenen und Verschwie.genen. In „Shanghai fern von wo“ arbeitet sie die Geschichte der österreichischen und deutschen jüdischen Emigranten auf, und in ihrem Roman „Landgericht“, für den sie mit dem Deutschen Buchpreis 2012 ausgezeichnet wurde, rekonstru.iert sie die Geschichte einer Rückkehr. Über das Spannungs.feld zwischen Lebensbericht und Fiktion sowie die Verdrän.gung des künstlerischen Schaffens von Frauen sprach mit ihr Gisella Linschinger bei den Literaturtagen „Bruits de Lan.gues“ in Poitiers, Frankreich.
Frau Krechel, Sie beschäftigen sich seit den frühen achtziger Jahren mit dem Schicksal von jüdischen Emigranten in Shanghai. Was bewegt Sie zu dieser Arbeit?
Ich habe zuerst nach dem Studium mich mit Autoren, die in der Emigration waren, beschäftigt, habe gelesen, was für große Traumata zurückblieben, zum Beispiel bei Nelly Sachs, die ja einen Verfolgungswahn hatte2, der durch die Emigration bedingt war, durch den Verlust des „toten Bräutigams“, wie sie ihn in einem Gedicht genannt hat. Ich habe mich mit Joseph Roth beschäftigt, habe mich mit Ernst Weiß beschäftigt und fand im Nachhinein es sehr problematisch, dass wir die Menschen, die ein Werk hinter.lassen haben, kennen, aber dass die vielen Unbekannten, von denen wir nichts wissen, auch für die Nachgeborenen nicht sonderlich in Erscheinung treten. Daraufhin begann ich einfach zu arbeiten, mir etwas anzuschauen, und als ich 1980 zum ersten Mal in Shanghai war, begriff ich, dass Shanghai ein Ort der deutschsprachigen Emigration war.
Von da an wollte ich sehr viel wissen, über gerade diesen exotischen Ort und die 18.000, die dort ohne Visum, mit nichts als einem Koffer hingekommen sind.
Warum war es möglich, nach Shanghai ohne Visum einzureisen?
Es war möglich, einzureisen, weil Shanghai eine offene Stadt war, die vom üblichen China abgeschnitten war. Es war eine offene Stadt seit 1843, seit China nach dem ersten Opiumkrieg die Stadt an die Engländer abgeben musste. Das heißt, sie waren nicht mehr Herr im eigenen Land und später kam noch eine internationale Regierung dazu, es gab eine französische Konzession, eine inter.nationale, und später sind andere Teile im japanisch-chinesischen Krieg auch noch unter die japanische Ver.waltung gekommen.
Unter den 18.000 Flüchtlingen waren auch verhältnismäßig viele Österreicherinnen und Österreicher. Woran lag das?
Das lag daran, dass 1938 beim Anschluss Österreichs die Nazis ihre "deutschen" Erfahrungen genutzt und alle Verordnungen, die sie von 1933 bis 38 in Deutschland erlassen haben, in ganz kurzer Zeit in Österreich durch.geführt haben. Das heißt der Schock in Österreich, die plötzliche Erniedrigung, war unglaublich heftiger, und das heißt ebenfalls, innerhalb von ein paar Tagen war in Österreich die Lage so, dass, wer fliehen konnte, geflo.hen ist. In Deutschland glaubte man noch, jemand war Weltkriegsteilnehmer, man hat Verdienste. Zuerst dach.te man, es würde nur die Ostjuden treffen. Aber dass es alle treffen würde, war zuerst gar nicht vor.stellbar.
Wie schreibt man über Menschen, die ihre Heimat verloren haben?
Ich versuche, es so einfühlsam oder so intensiv zu ma.chen und denke natürlich auch an heutige Migranten, die unter uns leben, die auch zum Teil an Wände sto.ßen, die zum Teil aus Bürgerkriegsländern oder eben mit schweren Traumata kommen. Und ich versuche, wenn es möglich ist, für die Stationen ihres Lebens so viele Quellen zu benutzen wie möglich.
Sind viele von den Menschen, die nach Shanghai ge.gangen sind, nach dem Krieg zurückgekehrt?
Nein, es sind sehr wenige nach Deutschland oder Öster.reich zurückgekehrt. Erstens, weil sie sicher Angst hat.ten vor den Nachwehen des Faschismus, zweitens haben sie überall auf der Welt Verwandte gesucht und das war eben anderswo, und drittens, das war wahrscheinlich der wichtigste Grund, dass es gar keine Verwandten in Deutschland mehr gab, dass sie also ohnehin vor dem Nichts standen.
In Ihrem Roman "Landgericht" berichten Sie über einen Richter, der aus dem kubanischen Exil zu.rückkehrt, nämlich Richard Kornitzer, der von sei.ner Frau zurückgefordert wird. Wie kann man sich dieses Verfahren vorstellen und was hat Sie an der Figur Richard Kornitzer so fasziniert?
Das "Zurückfordern" hieß, dass diese Frau, die ja den Kontakt zu ihrem Mann verloren hatte, ans Rote Kreuz und an jüdische Organisationen geschrieben hat. Es gab ja keine Post zwischen Deutschland und einem alliierten Land; Kuba war mit den USA alliiert. Es wurden nach dem Krieg von allen möglichen Stellen Adressen gesam.melt, damit man die Leute wieder zusammenbringen konnte. Und sie hat auch an das Landratsamt Lindau am Bodensee, geschrieben, wohin es sie verschlagen hatte, und einen Aufruf unterschrieben, dass sie zwar nicht Jü.din sei, aber dass man ihr helfen solle, ihren jüdischen Mann zu finden. Und das ist schließlich gelungen und er ist gekommen. Wie schwer ein Zusammentreffen für ein Paar nach zehn Jahren ist, das musste ich mir vorstellen, dafür musste ich Formen finden. Es ist natürlich etwas unglaublich Kompliziertes.
Wäre er auch ohne ihre Initiative zurückgekommen?
Es ist schwer, über Romanfiguren zu spekulieren: Wenn ich einen anderen Weg gefunden hätte als diesen … Ich wollte ihn zurückkehren lassen und das entsprach auch den Materialien, die ich benutzte. Ich versuchte, das Kuba-Kapitel so heiter oder so ganz anders zu machen als die anderen Kapitel. Es ist ein sehr langes Kapitel, hundert Seiten, eigentlich schon ein Buch im Buch, und ich versuchte da, bei diesem doch strengen und rigiden und sehr preußischen Mann eine andere Seite aufschei.nen zu lassen, die ihn vielleicht selbst verwirrt hat oder ihm ein anderes Leben möglich erscheinen lassen sollte, aber das wäre natürlich ein ganz anderer Roman gewe.sen.
Wie ist das Verhältnis zwischen Fiktion und Tatsache in Ihrem Schreiben, beziehungsweise in diesen beiden Romanen?
Das kann ich so allgemein nicht sagen. Ich war bestrebt, so lang es noch Menschen gibt, die unter den Folgen ihre Emigration und den Folgen der Traumatisierung durch den Faschismus leiden, Romanfiguren zu „konstruieren“. Es wäre mir sonst unethisch erschienen. Weitestmöglich habe ich mich, was die äußeren Bedingungen angeht, an Berichte, Lebensberichte gehalten. Wie ich sie aber ver.knüpft und in welchen Zusammenhang ich sie gestellt habe, das ist natürlich meine Entscheidung. Auch die Be.ziehungen zwischen den Personen, das Atmosphärische selbstverständlich, die Konstruktion – all das ist meine Entscheidung. Das kann niemand aus Lebensberichten entnehmen.
Stichwort Lebensberichte: Seit Ihren Anfängen als Schriftstellerin schreiben Sie Essays über berühmte, oder weniger berühmte, aber wichtige Frauenper.sönlichkeiten. Im März 2015 ist im Salzburger Jung und Jung Verlag das Buch "Stark und leise. Pionie.rinnen" erschienen. Können Sie uns dazu ein paar Worte sagen?
Als ich eine junge Autorin war, bin ich davon ausgegan.gen, dass die Gesellschaft immer wieder neue Gründe konstruiert, um die literarische oder auch künstlerische Arbeit von Frauen zu vergessen. Für alle stehen Gründe bereit, aber man hat nie gesagt: Man vergisst sie, weil sie Frauen sind. Das war immer trickreicher. Und ich bin davon ausgegangen – natürlich –, dass mein Werk eines Tages vergessen sein würde. Vermutlich wird es nicht mehr so sein, das beruhigt mich in gewisser Weise. Aber es war mir immer wichtig, auf solchen Spuren zu gehen. Ein früher Aufsatz, den ich geschrieben habe, handelt von Irmgard Keun. Ich habe sie tatsächlich aufgetrieben, als sie vollkommen unbekannt oder eben in einer sehr, sehr schwierigen Lebenssituation war. Ich habe ver.sucht, etwas für sie zu tun, und das ist auch gelungen, und so ging es weiter, bis ich eben auch über bekanntere Autorinnen schrieb. In diesem Band ist ein Text über Frie.derike Mayröcker, einer über Ingeborg Bachmann, einer über Hannah Höch, einer über die Psychoanalytikerin Charlotte Wolff, die eine hochinteressante Theorie der Bisexualität geschrieben hat. Sie war auch Emigrantin, sie hat später in London gewirkt. Und an diesen Punk.ten, die also gar nicht so verschieden sind von meinem anderen Schreiben, bin ich sehr interessiert. Es gibt ein Gedicht von mir zu Gertrud Kolmar, also da verzahnt sich das Essayistische und das Poetische sehr.
Gibt es etwas, das Sie jungen Frauen und jungen Au.torinnen im Speziellen auf den Weg mitgeben würden?
Hm, das hört sich immer ein wenig tantenhaft an, wenn man so etwas sagt. (Lachen) Ja, ich habe viel mit jungen Autorinnen in Berlin gearbeitet, im Literarischen Collo.quium, in dem sie ein Stipendium hatten, ich habe sie, während sie ihren ersten Roman oder ein Erzählungs.werk schrieben, betreut, war ihre Mentorin. Ich bin der Meinung, sie sollten bis an die Grenzen dessen gehen, was sie wagen, sie sollen nicht das tun, was jetzt alle tun, sondern wirklich ihr Eigenstes machen und auch dabei nicht links und rechts schauen und sich nicht ent.mutigen lassen.
Ursula Krechel
studierte Germanistik, Theaterwissenschaft und Kunstgeschich.te und promovierte über den Theaterkritiker Herbert Ihering. Sie lehrte an der Universität der Künste Berlin, dem Literaturinstitut Leipzig, der Washington University St. Louis. Sechs Jahre lang betreute sie die Werkstatt Prosa im Literarischen Colloquium Berlin. 1973 debütierte sie mit einem Theaterstück Erika. Für ihren Roman Shanghai fern von wo wurde sie mit dem Deutschen Kritikerpreis, dem Jeanette Schocken Preis, dem Düsseldorfer Literatur-Preis und dem Joseph Breitbach-Preis ausgezeichnet. 2012 erhielt sie für ihren Roman Landgericht den Deutschen Buchpreis. Sie ist Mitglied der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung Darmstadt und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz.