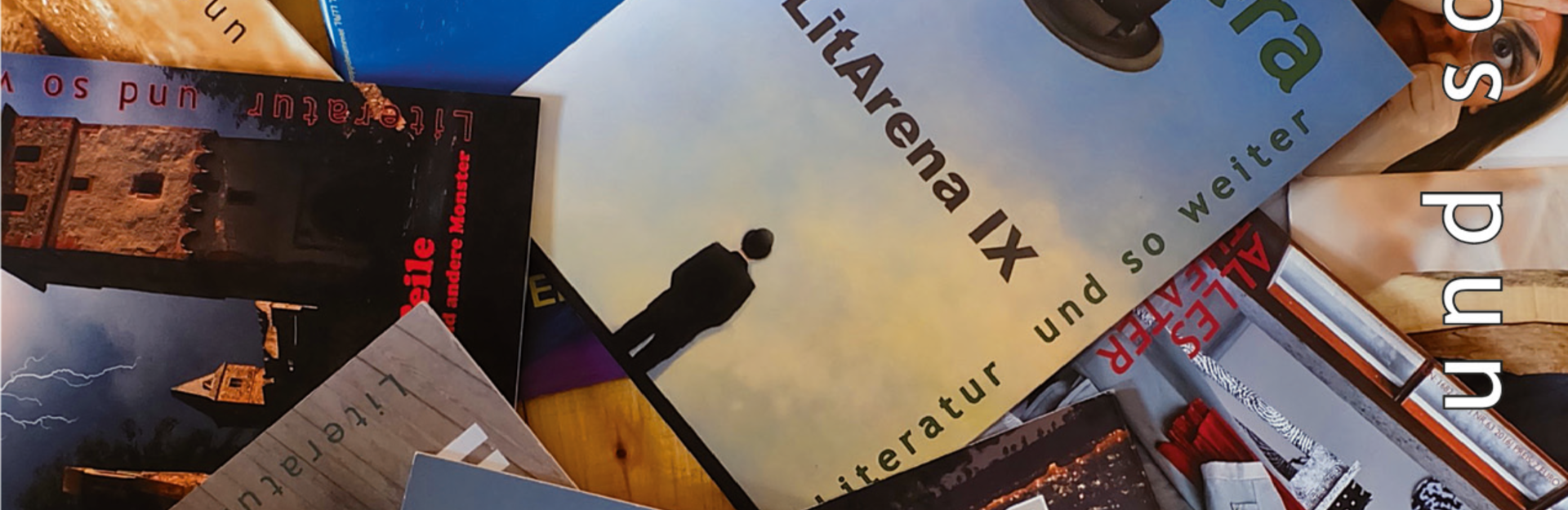Alois Vogel
ALOIS VOGEL
im Gespräch mit Alois Eder
und Maria Seitz
erschienen im etcetera/
Mag. Alois Eder und Mag. Maria Seitz im Gespräch mit Prof. Alois Vogel, Jahrgang 1922, der im April 2005 gestorben ist. Seine Leistungen für die Literatur in Niederösterreich: Die Herausgabe des Jahrbuchs "Konfigurationen" 1965-72, die Mitbegründung des Vereins Podium 1970 und die Mitherausgabe seiner Zeitschrift bis 1992 bzw. der Reihe "Lyrik aus Österreich". 1977 wurde er mit dem Würdigungspreis des Landes Nö. für Kultur geehrt, eine fünfbändige Werkausgabe im Verlag Deuticke wurde von H. Peschina, A. Obermayer und W. Schmidt-Dengler herausgegeben, darunter Lyrik und die Romane "Schlagschatten" und "Totale Verdunkelung."
Wenn man die Reaktionen auf die Zeitgeschichte in Bezug auf die Zwischen- und Nachkriegszeit betrachtet, sollten wir die Vergangenheit heute überhaupt noch als großes Thema sehen?
Die Vergangenheit sollte gerade heute behandelt werden, gerade die Entwicklungen in der letzten Zeit zeigen das. Da können wir gleich anfangen mit dem Schlagschatten, den ich geschrieben habe, er ist über das 34er Jahr geschrieben, und mein Freund meinte dazu: Was? Über´s 34er Jahr hast du was geschrieben? Das kannst du dir an den Hut stecken. Der Roman geht über drei Generationen. Geschrieben habe ich ihn in den 50er Jahren, cirka 1955, er wurde aber angelehnt; besonders in Österreich kam er nicht an. Nach Deutschland hab ich ihn auch geschickt, der Rowohlt-Verlag antwortete mir: Wir bringen keine Heimatromane! (Da war am Anfang ein Förster, dann ist das natürlich ein Heimatroman). Herausgegeben wurde er dann erstmals 1964.
War Ihnen wichtig, dass Sie irgendeine Sprache des Widerstands gefunden haben?
Mir war wichtig, dass man diese Zeit auch dokumentiert.
Haben Sie dabei aus Ihrem Leben irgendwelche Schlüsselerlebnisse verarbeitet?
No ja, es waren doch Erlebnisse, in meinem Roman kommen doch Figuren drinnen vor, die ich praktisch auch gekannt habe, die existiert haben, aber nicht gerade alle in dieser Form.. Denn ich war in den 30er Jahren grad um die 12 Jahre alt. Aber es hat einen Herrn Werner gegeben, der bei der RAWAG Rusten gestanden ist, wie ich schreib, und er wohnte auch am Leopoldsberg, wie ich schreib. Die Förster waren seine Eltern und ich war als Kind bei dem Förster in Kost (mein Vater war 9 Jahre arbeitslos). So hab ich das Milieu kennen gelernt.
Trauen sich vielleicht erst die nach 45 Geborenen so richtig, das Thema zu behandeln?
Ich glaube, die Jungen trauen sich das. Ich glaube, meine Generation hat sich das nicht getraut weil sie wussten, was sich da getan hat, weil das so vielschichtig war, und die Jungen schrieben so frisch weg ohne Hemmnisse, aber meiner Meinung nach ohne Tiefgang.
Kurz nach ´45 wurde in Österreich viel zum Thema geschrieben, dann gab es eine kurze Reaktionsphase, aber in der Koalitionsära wurde es still, erst ab 1970 sind Autoren wieder damit herausgekommen.
Die Zeit ganz knapp nach ´45 ist nicht interessant, erst ab ´70. Wer, wer hätte geschrieben ganz kurz nach dem Krieg? Der Dor vielleicht, net woa...
Die Feiks-Waldhäusl schrieb in St. Pölten einen Anti-Nazi- historischen Roman. Vielleicht schrieben keine bekannt gewordenen Autoren! Und sie behandelten diese Themen auch nur am Rande. Viele Verlage sind nach dem Krieg aus dem Boden geschossen. Bei der jungen Generation ist vielleicht die Vielschichtigkeit weg.
Die is weg. Weil sie ja auch gar net wissen können, weil sie nur mehr von der Literatur leben, und weil die Literatur ja so vielschichtig ist, man müsste die Schwarzen, die Roten, die Braunen, alle müsste man lesen, na? Und dann ist ja bei vielen gar nichts da, nicht? Ich meine, literarisch.
Menasse, Haslinger? Was meinen Sie mit dieser Vielschichtigkeit?
Na ja, meine ich, dass mehr die, die die Zeit erlebt haben, vielmehr wissen, warum einer NSDAP-Parteigenosse war. Die Jungen sagen, na, das war a Parteigenosse, alles in einen Topf, da gehören in einen Topf alle Braunen hinein, in einen anderen alle roten, viele bei der NSDAP waren aber eigentlich Rote, na? Oder auch Schwarze.
Man konnte einzelne Personen also nicht gut einordnen.
Man konnte sie nur einordnen, wenn man sie gekannt hat. Was man von Büchern wissen kann, ist pauschal. Z.B., wenn der Stadtrat Matejka nach dem Krieg gleich gestorben wäre, wäre er als Schwarzer gestorben, er war aber bei der vaterländischen Front, war sogar Volksbildner, aber in Wirklichkeit war der NIE ein Schwarzer.
Er war auch Kommunist.
Eben, eben, also wie will das jetzt einer, der den Matejka weder vorher noch nachher gekannt hat, wissen?
Viele, die geschrieben haben, denen war es ein Anliegen, das Zeitgeschehen zu dokumentieren, die sind aber ins Exil gegangen bzw. mussten sie ins Exil gehen. Nach ihrer Rückkehr sind sie aber nicht gerade mit rotem Teppich empfangen worden, sondern generell eher mit Schweigen.
Ja, natürlich. Das ist sehr wichtig.
Sie haben zu schreiben begonnen, als Sie in Russland waren, stimmt das? Warum begannen Sie zu schreiben? Aus Liebe zur Literatur oder aus politischen Gründen?
Ich habe zu schreiben begonnen, weil mich erstens der russische Mensch angesprochen hat und die russische Landschaft, also gar nicht so sehr aus politischen Gründen, sondern man hat ich bin bei der Luftwaffe gewesen Gott sei Dank die ganzen 5 Jahre wo ich dort war keinen scharfen Schuss abgeben brauchen. Ich hab immer nur mit Schraubenziehern und -schlüsseln hantiert, daher habe ich da weniger Komplexe gehabt, ich habe russische Zivilisten kennen gelernt, wir waren einquartiert in einem kleinen Örtchen in einem Bauernhaus, die Bäuerin hat mich, als ich einmal krank wurde, betreut wie ein eigenes Kind. Also und wirklich habe ich eine gute Beziehung zu den Russen gehabt. Beim Durchbruch der Russen in Stalingrad da sind wir geflohen, einzeln zurück, in einer Kolchose sind wir einmal gesessen, erschöpft eingeschlafen, auf einmal hat uns ein Russe aufgeweckt und weggeschickt, er hätte uns auch mit einem Ziegelstein erschlagen können.
Das heißt, für Sie persönlich war der Krieg nicht so ganz dramatisch.
Nein, aber zu meinem Rückblick ist zu sagen, im vorletzten Band, der herausgegeben wird, spielt die vorletzte Erzählung in Russland.
Ist die Gesamtausgabe Ihrer Werke schon fertig erschienen?
Nein, vorige Woche ist der zweite Band erschienen, im Jänner kommt der nächste. Kommen wir zurück zur Vergangenheitsbewältigung ich glaube, Fritsch und Lebert spielen eine Rolle, glaube schon.
Wer hat denn eigentlich das Eis gebrochen, doch nicht der Doderer?
Na der sicher nicht nein, der Lebert, der ist da ganz groß herauszustreichen.
Dann musste sich wohl auch die Situation bei den Verlagen ändern?
Die Verlagssituation war schwierig. Dadurch dass der Lebert das angesprochen hat und Erfolg gehabt hat, glaube ich, dass dann doch langsam, langsam, langsam... Es ist ja noch eine Story. Als der Schlagschatten das erste Mal erschienen ist, beim Nett Verlag, jetzt nicht mehr existent, da saß ich etliche Male mit meinem Lektor beisammen, wir haben durchgearbeitet, Korrekturen gemacht, und einmal kommt die Frau um Mitternacht rein, damals ist gerade das Sechzigste Jahr von der Bachmann erschienen, und sagt, Sie, Herr Sowieso, wie gibt´s denn das, mit Erzählungen an so an Erfolg zu haben? Na, was sagt der [Lektor]? Ganz eine klassische Antwort, ich hab gelacht innerlich und mi hat des so gfreut. Ja, die Frau, sowieso, die ist mit einem Buch herausgekommen und da hat der Verlag draufgezahlt, mit an zweiten, an dritten, und Sie? Sie wollen ja gleich mit einem ersten Buch ein G´schäft machen? Hahaha, da hab i g´ lacht.
Man kann auch nachlesen bei Murray Hall´s Verlagsgeschichte, dass die österreichischen Verlage vielleicht mit Ausnahme von Zsolnay nie mehr zu der Form und Funktion im deutschen Sprachraum aufgelaufen sind, die sie vorher hatten.
Die österreichischen Verlage haben bei der deutschen Währungsreform sehr viel verloren, sie haben viele, x Kisten nicht verkauft. Kamen nicht mehr an, nur der Otto Müller. Der Müller hat den Riss gemacht mit dem Italiener Guareschi . Das bot ihm einen Kapitalsockel. Die Verlage konnten ins Ausland nicht mehr ausliefern, das war sehr schwierig.
In Österreich war es wichtig, nach dem Krieg eine Provinzialität herauszustreichen, da wurden die Dialekte, Dirndlkleider et cetera wiederbelebt.
Die österreichischen Verlage waren voller Heimatdichter, Donauland war nach dem Krieg sehr wichtig. Weinhebers Freunde waren beliebt und hielten zusammen. Ich habe meine Romane et cetera damals schon angeboten, zum Beispiel im NÖ Rundfunk. Da war gar nichts zu machen. Z.B. Ernst Waldinger. Die zelebrierten im Café Heumarkt. Die blieben noch lang dort. Herr Brenner auch! Ein Geistlicher. Hatten in der Vorkriegszeit schon Verlage, im Krieg haben sie sie behalten, als sie nach dem Krieg zurückkamen, z. B. Felix Braun; die Verlage bevorzugten diese Seite von der Literatur.
Haben Sie persönlich mitgefühlt, dass Leute, die Sie gekannt haben oder die Ihrem persönlichen Umfeld als junger Mensch entstammten, als Sie zurückgekommen sind, nicht mehr da waren? Haben Sie persönlich einen Verlust erlitten?
Nur insofern, dass mich kein Verlag genommen hat, nein, ich bin in einem Arbeiterbezirk aufgewachsen, habe keine Freunde / Emigranten gekannt, war erst vierzehn, in der Volksschule waren 2 Juden, später nur mehr ein Jude. Das habe ich beobachtet. Ich hatte aber keine Nähe zu Widerstandsaktivitäten.
Dass sich bei den Verlagen etwas geändert hat, ist das auch eine Frage der politischen Wende 68/70, als die Koalitionsära beendet war und Kreisky regierte hat sich das auf die Literatur direkt ausgewirkt?
Glaub´ ich schon, die wurde gefördert, sehr -
Aber das Thema wurde immer noch nicht angeschnitten, oder? Lebert, Fritsch, Dor. Den Fritsch hat man noch kritisiert, wegen des Romans Fasching über den ist man noch hergefahren -
- das war aber weniger politisch, weil sie dann auch über Lebert hätten herfahren müssen. Fasching war ein Skandalbuch wegen des Inhalts. Er schreibt von einem jungen Mann, der sich versteckt hat, er hat sich von einer älteren Dame verstecken lassen, ein Siebzehnjähriger, der hätte sollen zur HJ Heimatflak gehen. Da beschreibt er einen, der desertiert ist und ich glaub, ich kenn den, ich glaub das war der Beckmann. Ich habe seine Tagebücher gelesen, den Nachlassband. Er versteckte sich in Mädchenkleidern (davon schreibt auch Fritsch), und dass er in der Auslage gestanden ist, hat ein erigiertes Glied bekommen und Angst gehabt dass man das sieht. An solchen Sachen hat man sich damals mehr gestoßen als am Ganzen. Natürlich gab es damals noch den Kameradschaftsbund, und dagegen hat er gewettert, und die werden eine Stimmung gegen ihn gemacht haben.
Als 68er hatte ich den Eindruck, dass die Älteren nicht gerne darüber reden, aber mein Geschichte-Unterricht war gut. In der Wolfshaut wird die Situation des Schweigens symbolisch so schön dargestellt, die Bevölkerung hat alles Unangenehme unter den Tisch gekehrt. An heikle Themen hat sich der Autor nur herangepirscht. Es ist interessant, zu verfolgen, dass hier noch keine gemeinsame Sprache herrscht und man noch nicht darüber reden kann.
Ich habe sehr viel gelesen eine Zeit lang, Professoren sagten mir immer, das sei alles gar nicht so bekannt, was ich da wolle. Die Herren Professoren hätten das selbst nie gelernt. Das war die Generation, die cirka ´66 maturierte. Hier merkte man den Unterschied zwischen einerseits Menschen, die vor oder nach dem Krieg ihre Ausbildung gemacht hatten und die Berührungsängste zu dem Thema hatten und andererseits Leuten wie z.B. dem Dillinger, der Ministrant von Kardinal König war und von dieser Widerstandsgruppe, der sich traute und alles glatt heraussagte.
Auch in meinem Gymnasialunterricht war vieles nicht so klar wie später, als ich nachlas. Das Thema wurde nicht klar ausdiskutiert oder präsentiert, z.B. verschweigt das Literaturgeschichtsbuch Pochlatko ALLES, was mit dem Nationalsozialismus in Zusammenhang steht. Die Periode 1920-45 wird darin zusammengefasst unter Neuer Sachlichkeit, Blut und Boden, es gibt keine einzige Anspielung auf den Nationalsozialismus. Das wurde mir weitgehend erst im Nachhinein klar, an der Universität. Die Jahre 1920-45 Protestler forderten genau diese Erklärungen und Diskussionen ein, wollten genau wissen, wie es war. Grade 2/3 Jahre lang.
Zur Frage: Warum schreiben hauptsächlich junge Autoren darüber? glaube, der Grund ist nicht die sogenannte Gnade der späten Geburt, sondern dass nach ´68 auf allen Stellen der Presse und des Rundfunks alles GAVler waren. Die haben keinen anderen reingelassen, außer GAVler. Von den Älteren ist da niemand reingekommen.
Da war ja der Gegensatz zwischen älteren, beim PEN organisierten Autoren, und den jüngeren, die sich dann abgespalten haben und zur GAV gegangen sind.
Die haben alle Sektionen besetzt.
Ist es nur eine Zeitstimmung gewesen, dass es nur lauter junge Autoren waren?
Etliche PEN orientierte sind nicht reingekommen, z.B. Peter Henisch ging zur GAV und hatte dann erst Erfolg (...) Ein anderes Beispiel ist Schuh. Ich war mal mit dem Schuh aus, er fragte: Willst du nicht zur GAV gehen, aber ich erklärte ihm: Jetzt bin ich schon so lange beim PEN, das hat er eingesehen. In der Zeit haben die zwei, PEN und GAV, konkurriert wie Hund und Katz. Ich bin doch ausgetreten, doch das muss ich sagen: Die GAV hat einen Arierpakt geschlossen, wer beim PEN war, konnte nicht zur GAV; was ist das anderes als ein Arierpakt, umgekehrt war es nicht so.
Wieso ist es zum großen Gegensatz gekommen, wegen Hilde Spiel?
Ja, die hat das losgetreten.
In den 50er/60er Jahren hast du da die Wiener Gruppe gekannt?
Ja, schon, nur angehört habe ich dieser Gruppe nicht. Es ist quer durchgegangen. Jeannie Ebner war gegen die Alten und stand auf der Seite von Fritsch, obwohl sie nicht experimentiert hat. Aber sie hat sich eindeutig ausgesprochen. Jandl wollte auch Mitglied beim PEN Club werden, aber er wurde nicht aufgenommen. Anfang der 70er Jahre nahm das Podium PEN- und GAV- Mitglieder auf. Im ersten Heft kommt das vor: Buchstaben Experimente. Ich selbst habe mäßig Experimente betrieben, aber ich schockiere oft.
Sie Sind ja auch Lyriker. Sinkt der Stellenwert der Lyrik in der Literatur heute?
Sehe ich nicht so. Denn Lyrik war immer ein Minderheitenprogramm für die Gebildeteren. Viel mehr Menschen interessieren sich dafür als früher. Weil die Bildung breiter geworden ist. Jeder will seine Kinder in die Mittelschule schicken, das hätte man sich zu meiner Zeit nicht leisten können. Heute hat die Lyrik mehr Konkurrenz als früher.
Lyriker müssen sich also mehr bemühen. Sie selbst als Lyriker, wie erkennen Sie: DAS soll ein Gedicht werden, Jenes eine Erzählung, spüren Sie das vorher?
Ich glaub a Prosa braucht mehr gedankliche Vorbereitung als a Lyrik.
Lyrik kommt spontan?
Ich hab´ fast kein Gedicht in zwei Tagen geschrieben, ich hab´ jedes Gedicht mindestens zehn Mal geschrieben, oder fast, überarbeitet. Manchmal hab´ ich beim Roman zwei Monate keine Seite geschrieben, alles war weg, und ich war verzweifelt. Musste immer wieder dran denken, aber es ging nicht, es ging nicht, dann auf einmal doch wieder.
Wir danken Ihnen für das Gespräch, auf Wiedersehen.