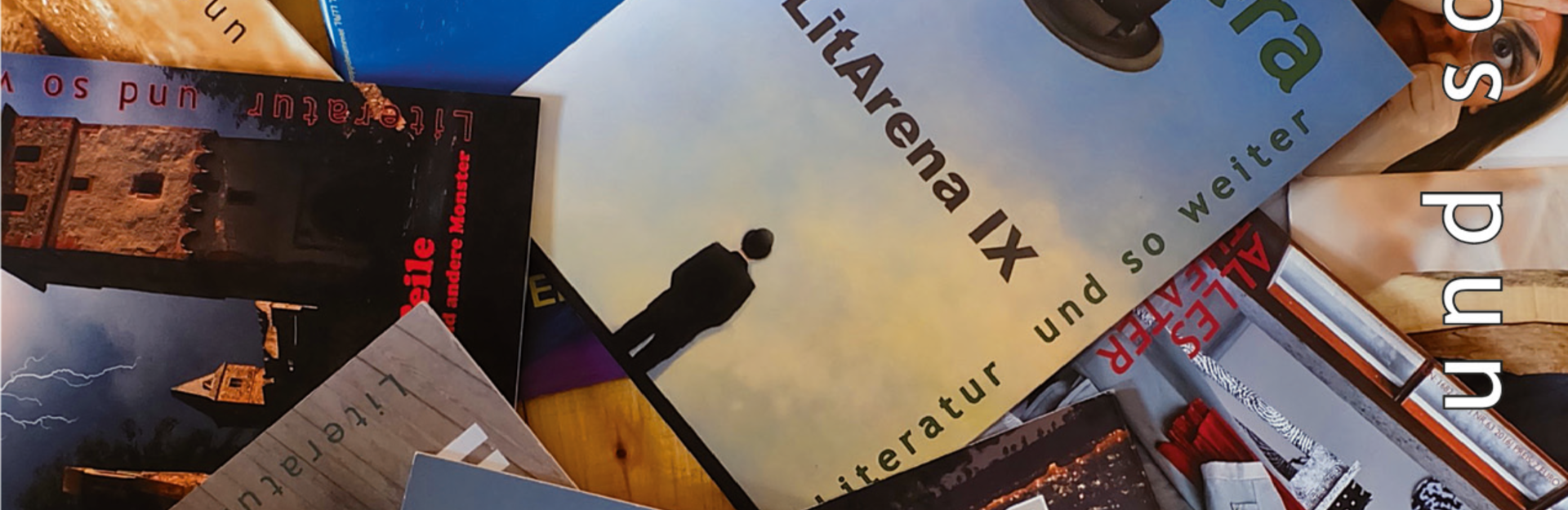Clemens J. Setz: Von elektrisierenden Vorstellungen. Ingrid Reichel
Clemens J. Setz
Von elektrisierenden Vorstellungen
 |
|
| Foto: Paul Schirnhofer |
Nach „Söhne und Planeten“, „Frequenzen“ folgte der Erzählband „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“, wofür der junge Grazer Autor den Belletristik Preis der Leipziger Buchmesse im März 2011 erhielt. Ingrid Reichel führte das Interview mit Clemens J. Setz per E-Mail im Mai desselben Jahres.
Lieber Clemens Setz, wenn man Ihre Bücher liest, verbindet man damit unweigerlich die Adjektive skurril, surreal, abgedreht bis krank. Ihr letztes Werk „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“, welches aus 18 Erzählungen besteht, scheint hierfür repräsentativ. Sind Sie mit diesen zu Ihrem Werk assoziativen Adjektiven einverstanden?
Es sind sicher keine irreführenden Adjektive, aber sie beleuchten nur eine Seite des Vielecks.
Wie sieht es mit den restlichen drei Ecken aus?
VieLeck.
Ah, ja …
Aber: Ich finde die Geschichten wirklich nicht besonders skurril oder krank. Zumindest sind sie nicht deswegen geschrieben worden. Manchmal sehe ich in ihnen auch kleine best case scenarios. Viele (nicht alle natürlich) haben auch happy ends, in einem gewissen Sinn.
Ihre Protagonisten erweisen sich alle als Anti-Helden, denn sie leiden an Handlungsunfähigkeit - Handlungsunfähigkeit im Sinne der Maßstäbe unserer Gesellschaft. Umso lebendiger werden die alltäglichen Gegenstände. Bin ich richtig in der Annahme, dass das Objekt für das Subjekt steht? (Wie kommt es Ihrer Ansicht nach dazu, dass der Mensch sich selbst eher über Dinge wahrnimmt als über andere Menschen?)
Ich glaube, sehr viele Menschen betrachten sich selbst als Dinge und beziehen aus dieser Vorstellung eine gewisse Stärke, einen gewissen Trost. Einem Ding kann man nicht so leicht Gewalt antun. So ähnlich wie man früher an uneinnehmbare und unberührbare Seelenkerne in Menschen geglaubt hat – auch aus dieser Vorstellung konnte man Kraft schöpfen. Wir hanteln uns eben von einer tröstlichen Vorstellung zur anderen. Irgendwann wird eine dieser Vorstellungen zu albern, zu lächerlich, und wir brauchen eine neue.
Als Leser bekommt man eine sehr persönliche aber konkrete Vorstellung ihrer Protagonisten. Ein Phänomen, wie ich meine, das in Kurzgeschichten selten erreicht wird. Auch wenn Sie diese Figuren an sich nicht beschreiben, werden sie durch die Objekte, die sie umgeben, eingegrenzt. Ich habe den Eindruck, dass Sie diese Personen über diese Objekte festhalten. Damit lassen Sie dem Leser einen ungeheuren Spielraum an Vorstellung. Ist Ihnen das bewusst?
Ist das bewusst, hm... Es hört sich zumindest nicht falsch an. Ob mir dieser Effekt, den Sie beschreiben, immer bewusst war, weiß ich nicht. Es ist natürlich eine oft verwendete Technik: Bevor man Figuren in Aktion erlebt, teilen sie sich (dem Autor und dann dem Leser) in gewissen rätselhaften Details mit, die oft mit Gegenständen, Kleidern, Accessoires etc. zu tun haben.
Meist sind Ihre Protagonisten mit Zwängen behaftet. Zunächst geht es um eine banale Alltagssituation, die Sie bis an die äußersten Grenzen ausreizen. Ist es für Sie ein psychologisches Spiel oder schreiben Sie sich in diese Empfindungen rein?
Na ja, ich glaube nicht, dass man das trennen kann. Ich möchte natürlich gern Erfahrungen machen, die ich noch nicht kenne, aber gleichzeitig kann man keine Literatur machen, die völlig abseits der eigenen Obsessionen und Besessenheiten spielt.
Die 18 Erzählungen verursachen ein Gefühl des Unbehagens… arbeiten Sie Ihr eigenes Unbehagen auf?
Nein, ich arbeite mit meinen Geschichten nichts auf. Ich erzeuge und verstärke vieles, das mir unheimlich ist, mich auf eine elektrisierende Weise verwirrt und mir in der Folge geeignet scheint, eine Offenbarung, vielleicht auch eine Epiphanie zu erzeugen, nach der die Welt kurz ein wenig heller und dichter und rätselhafter ist. Um Aufarbeitung irgendwelcher unbehaglichen Dinge geht es in der erzählenden Literatur generell nicht, sondern eher in der Politik, in der Geschichtsschreibung und natürlich in der Psychotherapie. Diese drei Dinge können durchaus einen Anteil an einem Stück Literatur haben, aber sie bilden doch nie dessen Essenz.
Bei Ihrer letzten Erzählung „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“ schenkt ein Künstler dem Volk ein Kunstwerk – ein Kind aus Ton – welches die Bevölkerung zur Vollendung bringen soll. In Ihrer Kurzgeschichte mutiert die Aufgabe zu einem Ergebnis, welches mich persönlich an den Beginn des Nationalsozialismus erinnert. War das Ihre Intention?
Nein, nicht wirklich. Aber dieser Gedanke ist verständlich, da Massenbewegungen, die mit einer Zunahme der Gewaltbereitschaft in der Bevölkerung zu tun haben, fast immer daran erinnern. Die Menschen in meiner Erzälhung haben ein Ventil für ihre Grausamkeit bekommen, das im Dienste einer an sich ganz wunderbaren Sache steht: der Schaffung eines ästhetischen Gegenstandes. Dieses Konzept unterscheidet sich natürlich schon sehr von dem Gewaltprinzip, das dem Nationalsozialismus innewohnt.
Natürlich, ich meinte auch das Ergebnis und nicht die Aufgabe als solche. Dennoch verarbeiten Sie in dieser Erzählung bis zur letzten Konsequenz die gedankliche Frage: Was passiert, wenn ich der Bevölkerung (Hinweis: Pöbel - populus!) uneingeschränkte Macht gebe?
Uneingeschränkt ist diese Macht ja nicht, sie beschränkt sich sogar auf einen sehr kleinen Bereich, eine einzelne Statue am Ende einer kurzen Sackgasse neben einem Park.
Das Ergebnis hat nicht viel mit dem Nationalsozialismus zu tun, mit täglichen Verdächtigungen, Denunziationen, mit dem plötzlichen Gewaltausbruch bezüglich bestimmter Teile der Bevölkerung usw. Meine Geschichte denkt wahrscheinlich eher über die Frage nach, ob man, wenn man Gewalt irgendwie neu kontextualisiert, tatsächlich irgendwann etwas Neues erhält oder bloß immer wieder Gewalt.
Sie meinen, wenn Menschen die Chance bekommen, gemeinsam etwas zu perfektionieren, wie es ja in Ihrer Erzählung der Fall ist, dann würde dies ein Ventil zu einer neuen Art der Gewaltausübung öffnen?
Es scheint mir, als würde es sehr oft in diese Richtung tendieren. Es ist ja inzwischen eine Binsenweisheit, dass sich so etwas oft bei Revolutionen beobachten lässt. Die Atmosphäre kurz nach der Entfernung der alten Machthaber ist immer von Jubel und Aufbruch geprägt, endlich Freiheit, endlich neue Möglichkeiten etc. Und dann, nach ein paar Monaten, hocken die Revolutionsführer auf irgendwelchen offiziellen Posten und prüfen nur noch akribisch, welche Teile der Bevölkerung sich nach den Ideen der Revolution verhalten und welche nicht. – Das ist jetzt allerdings so stark vereinfacht, dass es schon fast wieder falsch ist...
Ist das Schreiben für Sie selbst ein Bedürfnis und/ oder schreiben Sie bewusst für ein bestimmtes Publikum? Welche Zielgruppe der Leser, glauben Sie, interessiert sich für Ihre Bücher schlussendlich?
Natürlich ist das Schreiben ein Bedürfnis für mich. Wenn es nur eine Verrichtung wäre, der man mit Disziplin nachzugehen hat, wäre das ja unerträglich. So lange das Schreiben mir Erlebnisse und Empfindungen verschafft, die ich noch nie hatte, werde ich es wohl auch betreiben. Der Gedanke an ein Publikum kommt erst ab dem Zeitpunkt dazu, wenn das jeweilige Werk (Gedicht, Geschichte, Roman) vollendet ist. Dann stellt sich manchmal die Frage: Sollte das überhaupt veröffentlicht werden? Wen könnte das interessieren? Usw. Allerdings: Diese Überlegungen sind nie besonders stark oder beherrschend. Denn da ich es ohnehin nicht steuern kann, welche Menschen meine Bücher lesen, ist es mir auch nie wirklich eingefallen, mir diese Leser irgendwie bildlich oder nach ihren idealen Eigenschaften vorzustellen.
Prinzipiell arbeiten Sie mit Assoziationsketten und verursachen damit neue Assoziationsketten beim Leser. Wie gehen Sie damit um?
Ich hoffe, dass ein Leser sich bei der Lektüre meiner Bücher seine eigenen Assoziationen macht. Es gibt allerdings keine Möglichkeit für mich, irgendwie mit diesen neuen Assoziationsketten umzugehen, da ich in nur ganz wenigen Fällen mit Lesern überhaupt Kontakt habe.
Viele Autoren suchen den Kontakt zu ihren Lesern. Facebook wird hierfür gerne verwendet. Sie sind nun auch in/auf (?) Facebook zu finden. Sind Sie ein ambivalenter Kontaktsucher zu Ihrer Leserschaft? (☺)
Ich bin auf Facebook, verwende es aber weniger für Werbung, Lesetermine usw. Dafür bin ich zu faul. Ich stelle einfach hie und da irgendein Fundstück rauf, etwas, das ich gelesen habe oder das mir irgendwo anders untergekommen ist. Inzwischen langweilt es mich auch ein bisschen.
Aus reiner Neugierde: Sie begannen 2001 mit dem Lehramtstudium der Mathematik und Germanistik. Es ist nun nicht ersichtlich, ob Sie das Studium abgeschlossen oder ad acta gelegt haben?
Ad acta, ja.
Worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Kombination Mathematik und Sprache. Verzeihen Sie das Klischee, aber oft ist es doch so, dass sprachbegabte Menschen, für die Mathematik bzw. Naturwissenschaften nicht viel übrig haben. Umgekehrt, Menschen mit diesen Fähigkeiten sich oft als wortkarg erweisen. Die einstige Verbindung, dass Wissenschafter auch Philosophen waren, scheint in der Neuzeit verloren gegangen zu sein. Wie sehen Sie das?
Das Klischee ist tatsächlich sehr selten zu beobachten, eigenartig, dass es sich überhaupt noch hält. Meine Mathematik-Professoren auf der Uni waren überhaupt keine wortkargen, nerdigen Leute, sondern meist erklärte Ästheten, die auch ihre Liebe zu einem bestimmten Begriff oder einer Konstruktion suggestiv und mit Leidenschaft zum Ausdruck gebracht haben. Ich habe von den Germanisten viel seltener eine emotionale Aussage über ein bestimmtes Werk oder Konzept gehört.
Neben Ihrer schriftstellerischen Tätigkeit arbeiten Sie als Übersetzer. Sie haben von John Leake „Der Mann aus dem Fegefeuer. Das Doppelleben des Jack Unterweger“ (Entering Hades) vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Wie kam es dazu?
Das war relativ unspektakulär: Der Residenz-Verlag hat mich damals gefragt, ob ich das machen möchte, und ich habe mir gedacht, warum nicht.
Laut Buchcover sind Sie auch als Obertonsänger und Gelegenheitszauberer tätig. Wie kommt das? Und wo treten Sie auf? Ich meine, dass man als Literat während der kreativen Arbeit eher publikumsscheu ist. Abgesehen von den Lesungen als Schriftsteller ist das Singen und Zaubern doch eine sehr publikumsnahe Beschäftigung. Bedeuten diese Tätigkeiten für Sie einen Ausgleich? Oder gibt es eine Verbindung zwischen dem Schreiben und dem Zaubern?
Ich bin nicht publikumsscheu. Aber ich trete mit diesen Hobbys auch nicht (oder zumindest nicht oft) vor Publikum auf. Manchmal kann es ganz lustig sein, solche Spielereien in eine Autoren-Vita zu schreiben. Das liest sich ja sonst immer so trocken, hier geboren, das studiert, wohnte hier und da. Aber natürlich kann das lustige Verzieren dieses traditionell eher eintönigen Teils des Buchumschlags auch nach hinten losgehen, da jetzt natürlich alle immer bloß das sehen bzw. hören (Sing was vor, Mach mal einen Trick etc.) und das ist natürlich dumm, das hätte ich mir vorher überlegen sollen.
Was war der Grund, warum Sie vom Residenz Verlag zum Suhrkamp Verlag gewechselt sind? (Probieren darf ich die Frage, leider sehe ich Ihre Mimik nicht)
Obwohl ich eigentlich gar keine Grimasse schneide, wenn man mich nach dem Verlagswechsel Residenz-Suhrkamp fragt, glaube ich doch, dass es klüger ist, darüber nichts zu sagen.
Sie haben ein neues Skript bereits quasi fertig in Ihrer Schublade. Worum geht es in Ihrem nächsten Buch?
Zu meinem nächsten Buch mag ich nichts verraten. Erscheinen wird es voraussichtlich nächstes Jahr*, obwohl noch kein genauer Erscheinungstermin feststeht.
Ich erwarte mit Spannung Ihr nächstes Werk. Danke für das Interview.
*2012 (!)
Clemens Johann Setz
Geboren 1982 in Graz. 2001 begann er ein Lehramtsstudium der Mathematik und Germanistik an der Karl-Franzens-Universität. Neben dem Studium arbeitete Setz unter anderem als Übersetzer und veröffentlichte Gedichte und Erzählungen in Zeitschriften und Anthologien. Sein 2007 erschienener Debütroman „Söhne und Planeten“ (Residenz Verlag) gelangte auf die Shortlist des aspekte-Literaturpreises. Für ein besonders gelungenes literarisches Debüt wurde er 2008 vom österreichischen BUKK ausgezeichnet und zum Ingeborg-Bachmann-Preis eingeladen, wo er mit der Novelle „Die Waage“ den Ernst-Willner-Preis gewann. 2009 wurde sein zweiter Roman „Die Frequenzen“ (Residenz Verlag) für den Deutschen Buchpreis nominiert (Shortlist) und erhielt den Literaturpreis der Stadt Bremen. Für seinen Erzählband „Die Liebe zur Zeit des Mahlstädter Kindes“ (Suhrkamp Verlag, 2011) erhielt Setz 2011 den Preis der Leipziger Buchmesse im Bereich Belletristik. Rezension auf www.litges.at
LitGes, etcetera 47/ März 2012/ Unser dummer Pöbel meint