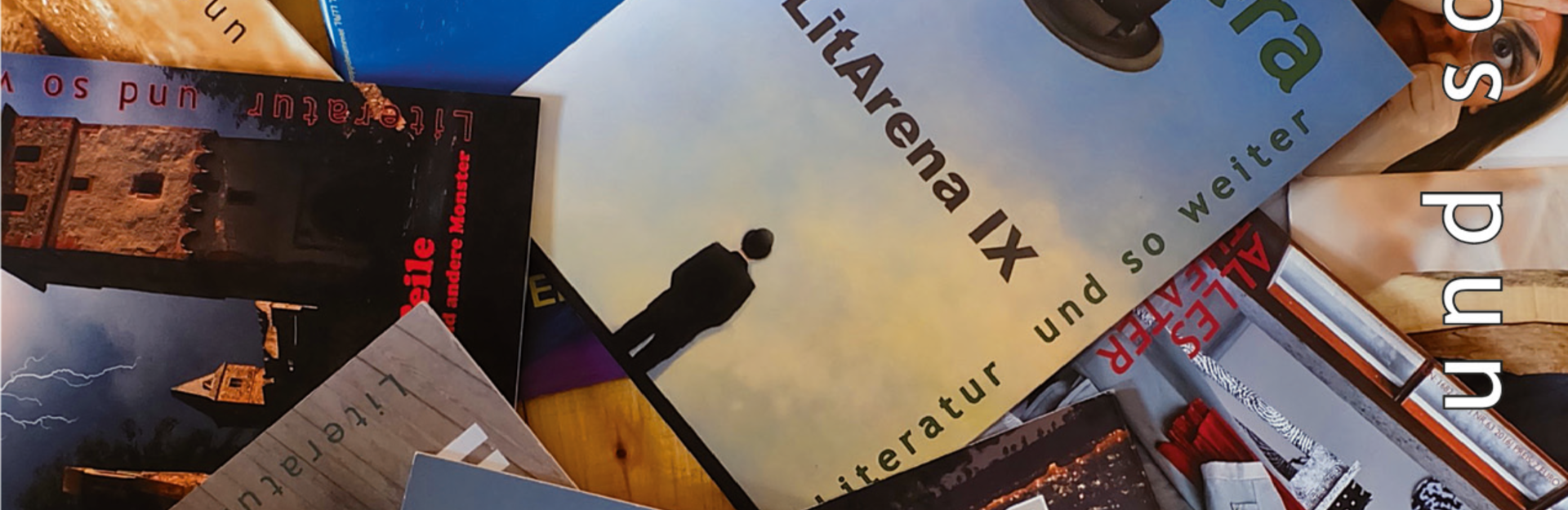Stefan Slupetzky: Den Lemming im Nacken. Martin Putschögl
Stefan Slupetzky
DEN LEMMING IM NACKEN
 |
Der Autor der beliebten "Lemming"-Kriminalromane, Stefan Slupetzky, spricht im Interview mit etcetera über Schubladen, aus denen er wieder heraus möchte, künftige Projekte und das Thema seines jüngsten Buches: den Lärm. Das Gespräch führte Martin Putschögl.
Herr Slupetzky, Ihr neuer "Lemming"-Roman "Der Zorn des Lemming" beginnt mit der Geburt des Sohnes von Lemming und Klara. Auch Sie selbst sind 2007 nochmals Vater geworden, da drängt sich die Frage auf, ob Stefan Slupetzky nicht zufällig auch einige von Lemmings Erfahrungen selbst gemacht hat?
Ja, und umgekehrt. Ich betone das immer wieder: Diese Wechselwirkung zwischen Fiktion und Realität funktioniert nicht nur in eine Richtung. Den dritten Band ("Das Schweigen des Lemming", Anm.) habe ich im April 2006 fertig geschrieben. Am Schluss wird Klara schwanger. Im September darauf hat dann auch meine Frau begonnen, Salzgurken zu essen (lacht). Es ist also wirklich so, dass das oft eine Wechselwirkung ist. Das bedingt auch meinen großen Respekt vor Dingen, die ich in meinem Privatleben vermeiden möchte. Im neuen Buch kommt ein kleines Kind, das noch nicht mal ein Jahr alt ist, auf sehr grausige Art zu Tode. Ich habe mit der Szene dann ganz bewusst gewartet, bis mein Sohn älter als ein Jahr war. Weil ich vermeiden wollte, dass es da auf irgendeiner Metaebene eine Kollision zwischen Fiktion und Realität gibt.
Das große Thema des Buches ist der Lärm. Auch das ist in gewisser Weise autobiografisch, denn Sie selbst mussten fünf Jahre lang einen Dachgeschoßausbau in Ihrem Wohnhaus erdulden.
Ja, ich musste zum Schreiben immer ins Café Luxor flüchten. Ich habe einen großen Innenhof, in den alle meine Räume hineingehen. Am anderen Ende des Hofes wird gerade wieder eine Wohnung renoviert. Die Handwerker kommen in der Früh um sieben, machen die Fenster auf und fangen an zu hämmern. Obwohl sie die Fenster auf der Straßenseite genauso öffnen hätten können. Aber sie öffnen die zum Innenhof. Mehrmals schon habe ich höflich gebeten, ob sie nicht auf der Straßenseite die Fenster aufmachen können. Und heute früh war das dann wieder so. Das hat dann schnell etwas sehr Demütigendes. Ich finde es entsetzlich, dass man sich da durch nichts geschützt fühlt.
Sind Sie da auch auf so Typen wie Hannes Gartner, den Immobilien-Hai in Ihrem Buch, gestoßen?
Also grundsätzlich sind alle Figuren immer ein Konglomerat aus teils erlebten und teils erfundenen Personen. Man nimmt hier ein Stück und dort ein Stück und schärft das Ganze dann. Exakt in dieser Form habe ich ihn also nicht erlebt.
Der Gartner ist für mich aber die Personifizierung dieses Undings, das da heißt: Profit machen und dafür anderen Leuten das Leben zu versauen. Von solchen Dingen höre ich auch im Freundeskreis immer wieder. Ein guter Freund von mir bewohnt beispielsweise mit seiner Familie einen alten Winzerhof. Dem haben sie jetzt daneben ein achtstöckiges Appartementhaus hochgezogen, und das gleiche soll auf dem Grund vor ihm passieren. Die Sonne ist weg, das alte Gemäuer ist von Rissen durchzogen, und seine Aussicht ist auch weg. Und das machen aber nicht Leute, die dort wohnen, sich wohlfühlen wollen, sondern das sind Leute, die einfach nur viel Geld aufs Konto haben wollen, und denen egal ist, wen sie damit behelligen.
Der neue Roman ist im Frühjahr erschienen, spielt aber im Jahr 2004. Auch im ersten "Lemming" gab es einen ähnlichen Sprung. Warum eigentlich diese zeitliche Differenz?
Den ersten Lemming habe ich schon 2000 oder 2001 geschrieben. Der Verlag, für den er eigentlich vorgesehen war, ein Kinderbuchverlag, der in den Erwachsenenbereich expandieren wollte, ist aber – damals zu meinem Entsetzen, jetzt zu meiner großen Freude – verkauft worden. Diese Pläne waren damit hinfällig. Die anschließende Verlagssuche hat drei Jahre gedauert. So ist der Zeitpunkt des ersten zu erklären.
Danach musste ich natürlich versuchen, die Chronologie des Leopold Wallisch (die Figur des "Lemming", Anm.) zu wahren, andererseits habe ich auch immer darauf geschaut, dass die Handlung zu einem Zeitpunkt spielt, an den ich mich noch gut erinnern kann. Ich nehme nämlich manchmal einfach auch Bezug auf real passierte Dinge. Das Erdbeben beispielsweise, das am Anfang des zweiten Romans – "Lemmings Himmelfahrt" – steht: Ich habe dazu recherchiert, zu welchem Tag und zu welcher Uhrzeit es im Wiener Becken ein Erdbeben gab – solche Dinge zu recherchieren, daran habe ich eine fast neurotische Freude. Im aktuellen Buch spielt der Tsunami in Südostasien im Dezember 2004 eine wichtige Rolle.
Beim Recherchieren ergibt sich oft aber auch so eine Art Wechselwirkung: Man hofft, dass dieses oder jenes vielleicht tatsächlich passiert ist, und recherchiert. Dabei kommt man aber auf ganz etwas anderes drauf, was die Handlung wiederum in eine bestimmte Richtung vorantreibt.
Wann schreiben Sie eigentlich? Gibt es eine bevorzugte Tageszeit?
Wenn ich wirklich mittendrin in einem Roman stecke, schreibe ich sieben Tage die Woche. Das heißt: Aufstehen, Kaffee kochen, Computer einschalten, los geht's. Mein Plansoll ist eine Seite am Tag. Das ist nicht gar so viel, aber ich bin da wahnsinnig penibel. Solange ich die eine Seite nicht erreicht habe, will ich nicht aufhören. Manchmal schaffe ich's trotzdem nicht, und das ist dann sehr unbefriedigend. Da sitze ich dann oft bis fünf oder sechs Uhr am Abend und quäle mich.
Werfen Sie dann am nächsten Tag üblicherweise auch wieder einiges weg?
Nein, das kommt eigentlich überhaupt nicht vor. Ich gehöre zu denen, die der Meinung sind, dass alles, was sie schreiben, perfekt sein muss. Ich gehe die Sachen auch danach nicht mehr durch. Es wird nichts mehr korrigiert oder verändert, wenn ich fertig bin. Trotzdem sagt mein Lektor: Wenn es lauter so Schriftsteller wie mich gäbe, wäre er arbeitslos.
Neben dem Lärm ist das Rauchen ein weiteres Thema im Buch. Auch hier fühlen sich Mitmenschen oft beeinträchtigt. Sie selbst sind Raucher, Sie rauchen auch beim Schreiben, und es scheint ganz so, als würde in einer bestimmten Szene, wo die Nichtraucher-Hysterie verteufelt wird, der Autor zu uns sprechen.
Ich finde den Vergleich zwischen Lärm und Rauch wunderbar, weil man daran gut erkennen kann, wie absurd und menschenverachtend sich diese Hysterie auswirkt. Ich bin kein Freund des Lärms und ich bin auch kein Freund lauter Musik; ich würde beispielsweise nie im Leben auf die Idee kommen, in eine Diskothek zu gehen. Ich würde deshalb aber auch nie auf die Idee kommen, Diskotheken verbieten zu wollen. Ich gehe nur einfach nicht hinein. Genau dieses Recht gesteht man den Rauchern derzeit zwar schon noch, bald möglicherweise aber nicht mehr zu. Nämlich jenes, dass sie sich unter ihresgleichen treffen und ohne auf der Straße oder im Regen frieren zu müssen miteinander ihrer Lust des Rauchens nachgehen können. Und das finde ich schon sehr hässlich. Es geht dabei nämlich nicht um den Schutz der Nichtraucher, sondern einfach um eine didaktische Maßnahme, die dem Volk verordnet wird.
Ich bin nun einmal Raucher, und ich bin keiner von denen, die sagen: Das ist so dumm, ich will's mir so gerne abgewöhnen, kann aber nicht. Nein, ich rauche gern! Und wenn ich im Konzentrationsprozess des Schreibens bin, dann stört das schlichtweg meine Konzentration, wenn ich zwischendurch nicht zur Zigarettenschachtel greifen darf.
Ich habe, wie schon erwähnt, neben meiner 20-jährigen Tochter auch einen zweijährigen Sohn, und ich weiß deshalb, wie wahnsinnig schwierig es ist, im Winter mit ihm irgendwo hineinzugehen. Deshalb bin ich auch damit einverstanden, dass es eine Ausweitung der Nichtraucherzonen gibt. Aber die Rigorosität, mit der das betrieben wird, ruft notgedrungen in mir einen Justament-Gegenstandpunkt hervor. mir scheint, es geht nicht um ein Miteinander und um Rücksichtnahme, sondern es geht echt um andere Dinge. Nämlich darum, zu sehen, wie weit man als Herrschender mit einem Volk gehen kann, wie viel sich die Leute gefallen lassen. Und sie lassen sich viel gefallen, sehr viel.
Glauben Sie, dass Sie als Schriftsteller was verändern können, die Leute in Ihrem Denken beeinflussen?
Ich glaube, dass es dem einen oder anderen, der dieses Problem auch hat, ganz gut tut, zu lesen, dass er nicht der einzige ist. Das stärkt einen ein bisschen, glaube ich. Hoffe ich. Man hat dann nicht das Gefühl, man sei krankhaft neurotisch oder überempfindlich, sondern man sieht, dass es sehr viele Leute gibt, die genauso denken. Oft genug werde ich ja auch wegen dieses Buches darauf angesprochen: "Ja, genau so ist es, genau das ist mir auch passiert!" Und das bestärkt dann natürlich auch mich in meiner Meinung.
Sie sind außerdem Kinderbuchautor und Illustrator. Fühlen Sie sich nach Ihrem Erfolg mit den Lemming-Krimis jetzt in der öffentlichen Wahrnehmung nicht ein bisschen reduziert auf den Krimi-Autor?
Das Etikett des Kinderbuchautors hat man gleich einmal auf sich draufpicken, und danach traut einem kaum noch jemand zu, auch Literatur für Erwachsene schreiben zu können. Weil das unausgesprochenerweise als weniger anspruchsvoll gilt. Ich hab's also geschafft, dieser Schublade zu entkommen, allerdings nur, um gleich in die nächste reinzurutschen. Ich habe ja auch schon Reisebücher gemacht, aber wahrgenommen werde ich als Krimiautor. Und ich find das auch irgendwie lustig, weil es Licht auf die Art wirft, wie unsere Gesellschaft mit Realität umgeht: Es muss alles einsortiert, eingekastelt und etikettiert werden.
Der erste "Lemming"-Roman, "Der Fall des Lemming", ist seit wenigen Wochen in den Kinos, mit Fritz Karl als "Lemming" und Roland Düringer als Bezirksinspektor Adolf Krotznig. Diesen gibt es im neuen Buch gar nicht mehr, weil Sie ihn schon davor "eliminierten". Haben Sie das beim Schreiben am vierten Roman bedauert?
Literarisch habe ich das überhaupt nicht bedauert, weil Krotznig für mich eine sehr eindimensionale Figur war. Er hatte wenig Facetten, war einfach nur grauslich. Und dementsprechend hat die Figur literarisch wenig hergegeben. Im Zuge der Drehbuch-Arbeiten hab ich das natürlich schon bedauert, weil doch die Hoffnung besteht, dass vielleicht auch der zweite "Lemming"-Roman verfilmt wird und eventuell auch der dritte. Und danach haben wir dann ein Problem, weil der Krotznig im Film natürlich sehr prominent ist.
Aus Lemming ist am Ende des neuen Buches ein Zornbinkel geworden. Wie geht es jetzt weiter? Sie haben bereits anklingen lassen, dass jetzt zunächst einmal Schluss ist mit dem Lemming …
Ich plane vorerst einmal nur, wieder einen Roman zu schreiben. Ob das Wort "Kriminal-" davor stehen wird oder nicht, das überlasse ich der Entwicklung der Geschichte, die ich ja noch nicht so genau kenne.
Aber jedenfalls ohne Lemming?
Ja. Ich denke mir nämlich, dass es einmal schon noch gehen muss, aus einer Schublade herauszukommen. Ich werde es zumindest probieren. Wenn es nicht klappt, werde ich vielleicht in ein paar Jahren reumütig beim Lemming anklopfen und ihn fragen, ob er bereit wäre, für einen weiteren Roman zur Verfügung zu stehen (lacht).
Wessen Lebensziel es ist, auf Altbewährtem herumzureiten und möglichst sichere Treffer zu landen, der sollte sich sowieso einen anderen Beruf suchen als den des Schriftstellers. Dass man Risiken eingeht, die Welt erforscht und Themen behandelt, die einen persönlich und menschlich gerade sehr interessieren, das ist ja der Reiz dieses Berufs. So in Serie ein Buch nach dem anderen im selben Schema herunterzuklopfen – da hätte ich ja gleich Buchhalter werden können.
Können Sie schon verraten, worum's in Ihrem nächsten Buch gehen wird?
Ich habe einen ganz groben Plot, oder vielmehr eine Grundidee, im Kopf. Da gibt's zwar Tote, und es geht auch um Investigation, aber es steht kein Verbrechen im Vordergrund. Mich interessiert etwas völlig anderes; nämlich ein Phänomen, das ich zunächst bei mir und dann in weiterer Folge bei einer ganzen Reihe meiner Freunde festgestellt habe, deren Väter verstorben sind: Dass es immer wieder Momente gibt, in denen die Fantasie einem vorgaukelt, der Vater hätte sein Ableben vielleicht nur vorgetäuscht. Einfach deshalb, weil man es nicht ertragen kann, dass dieser Mensch nicht mehr existiert. Und dann schlägt einem die Fantasie wirklich unglaubliche Kapriolen: Wie hätte er das bewerkstelligen können? Lebt er jetzt vielleicht in Chile als Schuster? Dieses Thema interessiert mich. Diese Unerträglichkeit, einen wichtigen, vielleicht den wichtigsten Menschen verloren zu haben, für immer. Und das hinzunehmen scheint den meisten Leuten nicht möglich zu sein.
Fürchten Sie eigentlich, dass Sie viele Leser wieder verprellen könnten, wenn Sie jetzt keinen "Lemming" mehr schreiben?
Nein, das fürchte ich nicht. Ohne jetzt überheblich sein zu wollen: Aber ich glaube, dass viele Leute, die die Lemming-Romane schätzen, das nicht nur deshalb tun, weil hier Leichen, Morde und Aufklärungen stattfinden, sondern auch aufgrund des Stils, der Denkweise etc. Und den Stil und die Denkweise würde ich ja nicht ablegen.
Stefan Slupetzky: Geb. 1962 in Wien, studierte an der Akademie der bildenden Künste, unterrichtete danach ein Jahr lang Kunst- und Werkerziehung an einem Wiener Gymnasium und lebt heute als freischaffender Autor und Illustrator in Wien. Zuletzt erschienen: "Lemmings Zorn", rororo 2009 ( Zur Rezension).