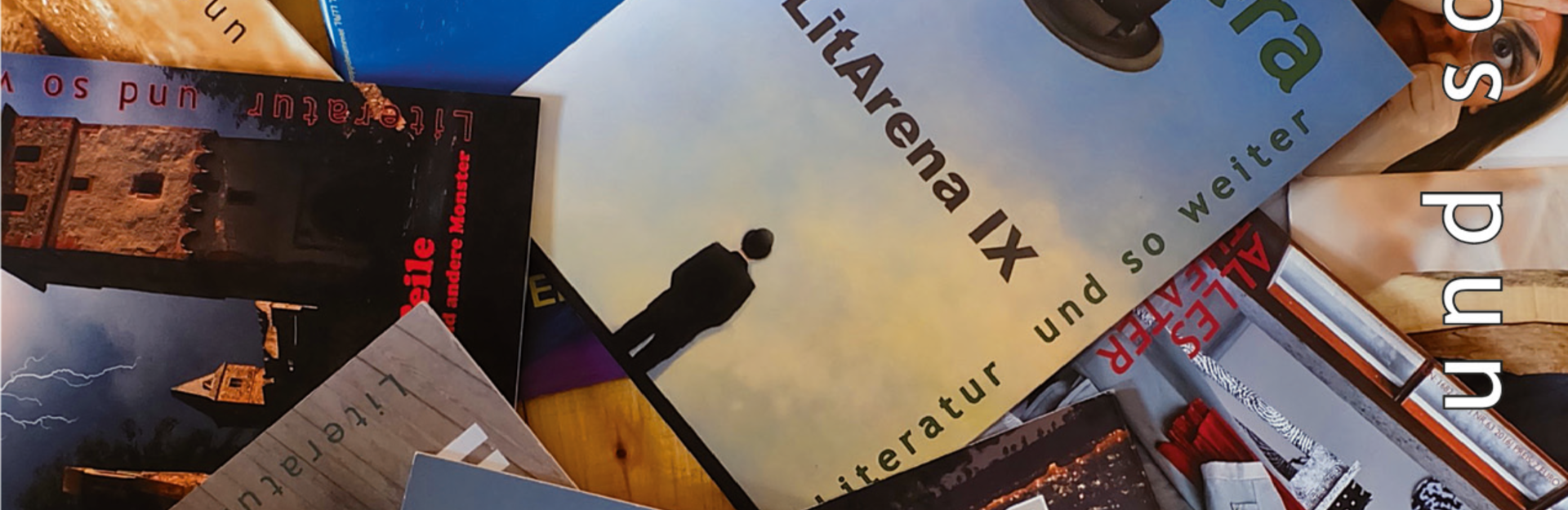Intervention:Werner Reiterer. Breath. Rez.: I. Reichel
Ingrid Reichel
DER SCHREI MIT SUCHTPOTENZIAL
Ausstellungsreihe Intervention:


WERNER REITERER.BREATH
Interaktive Licht- und Toninstallation
Oberes Belvedere, Marmorsaal
Eröffnung: 18.11.09
Ausstellungsdauer: 19.11.09 – 28.03.09.
Kurator: Rüdiger Andorfer
Ausstellungskatalog in Deutsch-Englisch:
WERNER REITERER. BREATH.
Ausstellungsreihe Intervention
Hg. Agnes Husslein-Arco
Wien: Belvedere, 2009. 64 S.
ISBN 978-3-901508-77-6
€ 15.-
„Der Schrei“ ist wohl eines der berühmtesten Themen Edward Munchs. Tiefe Verzweiflung und Depression drücken sich in der verzerrten Figur, die auf den vier verschiedenen Versionen schreit, aus. Doch der Schrei ist stumm. Dennoch bekommt die Gestalt all unsere Aufmerksamkeit, wir bleiben gebannt vor ihr stehen. Es ist diese Stummheit, die uns lähmt, wie in einem Albtraum, wenn man sich die Seele aus dem Leib schreit und trotzdem kein Ton herausbekommt …
Werner Reiterer bewirkt in seiner Installation „Breath“ (Atmen) mit der Auseinandersetzung des Schreis das komplette Gegenteil. Es handelt sich um den Schrei, der befreit, Tabus aufbricht, Konventionen, ja sogar Verhaltensregeln durchbricht und einen anschließend erschöpft oder auch entspannt atmen lässt. Hier speziell sind die Verhaltensregeln in den Museen gemeint, die eine gediegene gedämpfte, ich möchte fast sagen klerikale Demutshaltung erfordern.
„Breath“ ist eine interaktive Installation, was soviel bedeutet, dass es ohne Zutun des Besuchers, bzw. Betrachters kein Kunstwerk gibt. Eine weißer beidseitiger Klappständer, aufgestellt mitten im Marmorsaal des Belvedere, mit einer handgeschriebenen Anweisung in vier Sprachen (Deutsch, Englisch, Französische und Italienisch) „SCHREIEN SIE JETZT SO LAUT SIE KÖNNEN!“ ermutigt aktiv zu werden. Nur wer wirklich laut genug schreit, den vordefinierten Pegel der Lautstärke überschreitet, wird Zeuge einer elektronischen Verschaltung von Licht und Akustik im Raum: Alle Lüster beginnen dreimal auf- und abzudimmen, gleichzeitig ertönt über Lautsprecher, die in den Kronleuchtern versteckt sind, das „erschöpfte“ Atmen eines Menschen, wofür Reiterer seine eigene Stimme einsetzte. Der Raum, als tote Materie, wird somit durch den Schrei eines Menschen kurzfristig zum Leben erweckt. Der sehr hoch angesetzte Auslösepegel verlangt, um das Kunstwerk zu aktivieren, völlige Enthemmung und ein absolutes Ausgesetzsein anderen gegenüber, was die damit verbundene Gefahr der Bloßstellung beinhaltet.
Wir befinden uns allerdings in einem Museum und nicht in einer Schreitherapie, wir sind Teil eines Experiments, welches zwischen Tradition und Moderne versucht zu vermitteln. Das Obere Belvedere, welches die bedeutendste Sammlung österreichischer Kunst, die vom Mittelalter bis zur Gegenwart reicht, beherbergt, startete 2007 eine Ausstellungsreihe mit dem Namen „Intervention“. Hierfür lädt das Haus zweimal jährlich österreichische Künstler ein ihre Arbeit mit der Architektur, der Geschichte und der Sammlung des Belvederes zu konfrontieren. Nach Gudrun Kampl, Brigitte Kowanz, Franz Kampfer und Christian Hutzinger gab man nun dem 1964 geborenen Grazer Werner Reiterer die Möglichkeit der Auseinandersetzung. Reiterer studierte 1984-1988 bei Maximilian Melcher Grafik an der bildenden Akademie und nunmehrigen Universität Wien.
Die bereits erwähnte „absichtliche Regelverletzung setzt vielfältige Kommunikationsprozesse zwischen Publikum, Kunst und Institution in Gang.“ hofft Agnes Husslein-Arco, die Direktorin des Belvedere in ihrem Vorwort des Katalogs. Ob das vermutlich konservative Publikum des Belvedere diesen Kommunikationsprozess in Gang setzt oder ob es von vereinzelten Schreien eher aus der besinnlichen Betrachtung von Klimts Kuss gerissen werden wird, wird sich weisen. Bei der Eröffnung jedenfalls gab es keine Scheu, man schrie in Gruppen, um ja den Pegel zu übertreffen und den Prunkraum atmen zu lassen. Die gewaltigen Schreiexzesse waren jedenfalls deutlich hörbar bis ins Foyer vorgedrungen und erfüllten das ganze Schloss.
Der Katalog bietet abgesehen von einer siebenteiligen Fotoserie, die den bedauernswerten Versuch unternahm das interaktive Schauspiel des Lichts einzufangen, ein aufschlussreiches Interview des Kurators Rüdiger Andorfer mit dem Künstler vom
Reiterer arbeitet seit den 1980ern mit den Medien Zeichnung, Skulptur und Installation. Themenschwerpunkt sind die Traditionen und Muster menschlichen Verhaltens im öffentlichen Raum.
Mit „Breath“ führt Reiterer zwei Dinge zusammen: eine institutionelle Kritik und den Besucher als soziale Skulptur. Herrschaftliche Strukturen anzuschreien und Verhaltensregeln zu brechen, haben subversiven Charakter. Reiterer sieht seine Installation als „Serviceleistung“, da die Kunst „eine Dienstleisterin“ im idealsten Sinn sei.
In der Regel würden Menschen tun, was man ihnen aufträgt. Mit seiner Aufforderung „SCHREIEN SIE SO LAUT SIE KÖNNEN“ erhält der Besucher eine Legitimation etwas zu tun, was sonst wohl als störend empfunden und keine Befürwortung finden würde. „Das Museum eröffnet eine Parallelität, in der ich sozusagen die Sau rauslassen kann, ohne dass ich Sanktionen befürchten muss.“ (S. 32). Die einzige Sanktion, die man zu erwarten hätte, wäre, dass sich der elektronische Mechanismus nicht auslöst, eben erfolglos aktiv geworden zu sein, nicht laut genug geschrieen zu haben, weil man vielleicht doch zu gehemmt war und an sich zweifelte. Ein oder zwei Sekunden muss man eine bestimmte Mindestdezibelzahl erreichen, sonst würde „die installative Aktion des Aus- und Einatmens und Dimmens nicht aktiviert“. Bei denjenigen, die die Aufforderung (noch) nicht gelesen haben, nicht um die Installation und ihre Licht- und Tonkonsequenzen Bescheid wissen, nichts anderes als einen unkontrollierten Schrei wahrnehmen, wird „die ganze Schadenfreude und Peinlichkeit auf diesen einen Besucher, der es versucht hat, zurückkippen.“ Um dem Vorzubeugen konnte man auf anderen Plätzen, wo „Breath“ bereits installiert wurde, das soziale Verhalten der Gruppenbildung beobachten. Gemeinsam ist man eben lauter, in diesem Fall erfolgreicher, vor allem bleibt man in der Gruppe anonym und ist nicht Alleinverursacher und somit nicht verantwortlich. In den vereinigten Staaten konnte Reiterer bei zwei Einzelausstellungen sogar eine Welle von Hysterie erleben: „Nach zwei Stunden hat es mehrere Gruppierungen gegeben, die permanent diese Arbeit ausgelöst haben.“ Kurzum eine Arbeit mit Suchtpotenzial.
In seiner Arbeit sucht Reiterer nicht die Ästhetik. Er schütze sich vor Kategorisierung und Erwartungshaltungen. Egal in welcher Technik er arbeitet, alleine der Stil des Denkens hätte mentalen Wiedererkennungswert. (S.28) Natürlich bleibe es immer eine Frage der Finanzen, wie man seine Projekte realisieren könne, manche Ideen kämen zu früh. Reiterer, der in seinen kritischen Arbeiten immer wieder den Menschen als Skulptur einbringt, jedoch ausschließlich sich selbst darstellt, entzieht sich damit der Gefahr kritisiert oder gar verklagt zu werden: „In unserem aufgeklärten Zeitalter gibt es genau eine Person, mit der man alles machen darf – die eigene!“ (S. 38)
Schließlich unterhielten sich Andorfer und Reiterer noch um die Wichtigkeit von Philosophie, Religion und Wissenschaft in der bildenden Kunst. Die Religion, speziell die römisch-katholische Kirche, habe in der Gegenwartskunst kaum mehr Bedeutung, meint der Agnostiker. Weiters befürchtet er, „dass sich die bildende Kunst eher als schlechte Illustratorin für die Ideen der Philosophie hergibt“ (S. 38). Lieber sieht er eine Annäherung an die Wissenschaft, die wie die Kunst von der Neugierde getrieben wird.
Die Installation ist bis Ende März zu beschreien und bleibt dann als „Schläfer“ im Belvedere. Irgendwann wird sie wieder „ausgegraben“ werden, sieht Reiterer die Zukunft seiner Donation positiv entgegen.
Wer sofort mehr über diesen hervorragenden Künstler wissen will, kann sich einen virtuellen Rundgang durch die Einzelausstellung „Auge lutscht Welt“ aus dem Jahr 2007 im Kunsthaus Graz auf You Tube ansehen.
LitGes, November 2009