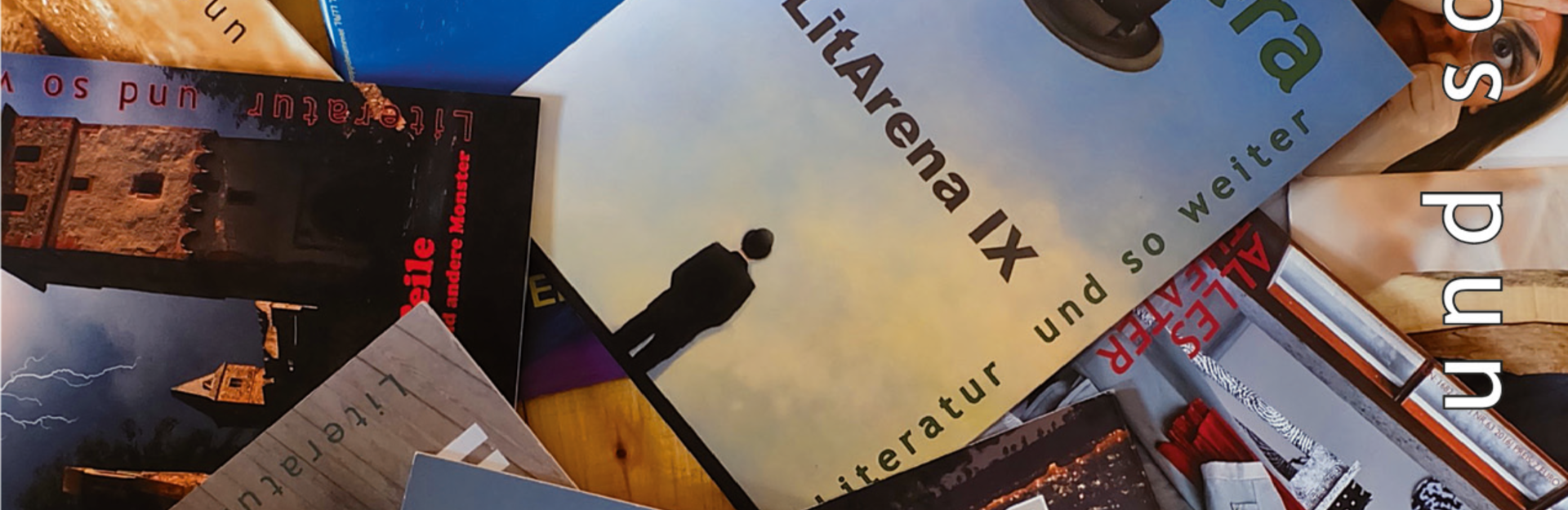Tartuffe: Molière. Rez.: Alois Eder
Alois Eder
KLASSIKER IN MODERNEN KLAMOTTEN?
 |
TARTUFFE
Molière
NÖ Landestheater St. Pölten
Premiere am 04.03.2006, 19:30 Uhr
Regie: Hans Escher
Notfalls könnte das St. Pöltner Stadttheater auf Harald Engelhardt, Beleuchter und Schüttelreimer mit eigener Homepage, zurückgreifen, der die neue Premiere spontan mit dem Zweizeiler Heut spielten sie die olle Mär, den "Tartuffe" von Molière ... ad notam nahm. Damit ist für einen ordentlichen Publikumszulauf eigentlich auch schon alles gesagt: Das St. Pöltner Ensemble bietet ohne Rückgriff auf barocke Kleider-Usancen eine hervorragende Gelegenheit zur Neu- oder Wiederbegegnung mit einem Klassiker der europäischen Komödie, nicht weniger, aber leider auch nicht mehr. Wer auf aktuelle Anspielungen und die Umsetzung des Heuchelei-Themas fürs 21. Jahrhundert hofft, wird das Haus zwar erheitert, aber nicht befriedigt verlassen. Dass Erwin Steinhauers Tartuffe kostümmäßig Anleihen einerseits bei dem Aufreger Mohammed-Karikaturen nimmt und anderseits durch die einheitlich orange Farbgebung der Frömmler aktuelle Bezüge andeutet, bleibt großteils unter der Wahrnehmungsgrenze, und nicht einmal die Werbedrucksachen spiegeln diese neueste Wendung der Scheinheiligkeit wieder, hoffentlich nicht aus Angst, auch in die Schusslinie der islamischen oder BZÖ-Fundamentalisten zu geraten.
Dass dann auch medienmäßig optimal vorbeworbene Schauspieler-Persönlichkeiten, neben dem Kabarettisten Steinhauer auch noch Louise Martini als Tartuffe-gläubige Mutter Pernelle des ebenso gläubigen Orgon, oder die Josefstädterin und EU-Abgeordnete Mercedes Echerer als vom Heuchler auf ihre Tugend geprüfte Ehefrau Elmire des letzteren keine speziellen Effekte in das alte Spiel einbringen können, liegt wohl am Klassiker-Flair der Verskomödie.
Wer wie der Referent keine Woche zuvor selber in einer allerdings Prosa-Komödie des großen Franzosen auf der Laienbühne stand, in seiner letzten, dem Eingebildeten Kranken (aufgeführt am Faschings-Lehrertheater im Institut der Englischen Fräulein) kann zwar einerseits die Routine der Professionellen in ihrem Wert besser einschätzen, gleichzeitig fällt ihm aber die Routine des Autors unangenehm auf, der beiden seinerzeit umstrittenen Stücken unbekümmert eine extrem ähnliche Familiensituation zugrundelegt: Im vom damaligen Pariser Erzbischof verbotenen Tartuffe aus dem Jahre 1663 ist es der Tugend-Gläubige Orgon (virtuos: Johannes Seilern), der dem Heuchler Haus und Vermögen verschreibt, im 1673 uraufgeführten Malade imaginaire, Molières letztem Stück, der Medizin-Gläubige Argan als Familienvater, dessen Reflexe von einer Intrige der zweiten Gattin ebenfalls als Anschlag auf sein Erbe gesteuert werden. In beiden Stücken vertreten eine Zofe (hier die Dorine Antje Hochholdingers) und ein Bruder (der Cléante Helmut Wiesingers) den gesunden Menschenverstand, in beiden Stücken leidet eine Tochter, die mit Gewalt an einen ungeliebten Partner verheiratet werden soll (hier die Mariane der Karin Yoko Jochum) an den geistigen Verirrungen der Väter.
Aber nicht nur die Personenkonstellation ist längst nicht mehr the state of the art, auch die Art der Entlarvung der Intriganten durch familiären Lauschangriff und schon gar nicht die Art und Weise, wie sich Tartuffe die Doppelmoral in sexualibus offenhält, entspricht einer modernen geistigen Deformation: Wer im Geheimen sündigt, sündigt nicht. Sünde ist, auch wenn a tempo der St. Pöltner Bischof Küng via Kurier vom selben Tag, S. 10, seiner Diözese eine Aufbruchskampagne zur Beschreitung neuer Wege nach den Vorkommnissen der vergangenen Jahre verordnet, keine allzu populäre moralische Kategorie.
Das Programmheft versucht, aber vielleicht mit nicht allzu tauglichen Mitteln, moderne Parallelen in den Kontext zu stellen, etwa mit einer längeren Passage aus dem Werk des Medienkritikers Neil Postman - noch deutlicher wäre vielleicht der Rückgriff auf George Orwells Double-think aus 1984 gewesen. Der moderne Heuchler ist weniger ein bewusster Intrigant als ein Schizophrener, der seine disparaten Bestrebungen gar nicht mehr unter einen Hut bringen kann. Und wo kein totalitäres Regime den Bürgern seine surreales Gedankensystem aufdrängt, wirkt die Orientierungslosigkeit im Informations-Dschungel noch verheerender auf den Geisteszustand der Zeitgenossen.
Moliére hatte sein aufmüpfiges und die damaligen Fundamentalisten zum Gegenschlag motivierendes Stück noch durch die Verweigerung eines kirchlichen Begräbnisses zu büßen,. Nichts derlei droht dem Dramaturgen, der das Stück auf das Programm des Niederösterreichischen Landestheaters gesetzt hat, es hat sein provokatives Flair weitgehend eingebüßt, vielleicht auch deshalb, weil Tartuffe als Laie weder ins Schema der geistlichen Erbschleicher passt, die noch Donna Leons Krimi-Venedig bevölkern, noch sich zu Anspielungen auf Priesterseminaristen eignet, die In Kinderpornos Erleichterung des Zölibatsdrucks suchen. Wo sind die Zeiten, in denen diese Bühne in einer Nathan-Aufführung mit der Rolle des Patriarchen dem Bischof in seiner Loge die Leviten gelesen hat?
Freilich, wie beim Eingebildeten Kranken wäre auch hier die Aktualisierung nur um den Preis eines neu geschriebnen Stücks zu haben gewesen. Müsste man zur Satire auf die heutige Medizin wohl eine Heldin ins Zentrum stellen, die der Schönheitschirurgie verfallen ist, so bei einer Modernisierung des Tartuffe vielleicht einen Theologen, dessen bibelkritische Studien ihn eigentlich in Clinch mit der Verkündigung bringen müssten, der aber trotzdem seinen Frieden mit der Tradition macht ...
Und genau die macht eine textgetreue und schwungvolle Inszenierung des alten Vergleichsstoffes immerhin frisch zugänglich: daher nach dem einzig in Louis-XIV.-Allonge-Perücke auftretenden königlichen Deus-ex-Machina-Boten Wolf Aurichs, der Tartuffe aus dem Verkehr zieht, rauschender Premièren-Applaus...