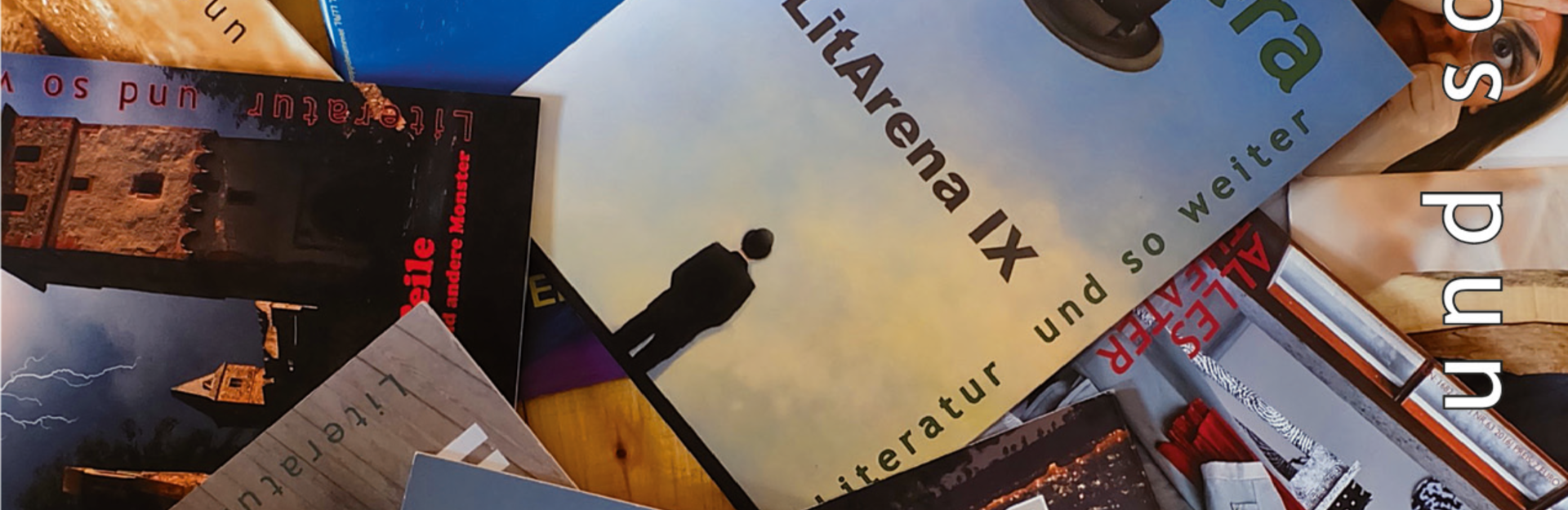Holzschlachten. Ein Stück Arbeit: Josef Bierbichler. Rez.: I. Reichel
Ingrid Reichel
VON DER SCHAM DES PUBLIKUMS
 |
HOLZSCHLACHTEN. EIN STÜCK ARBEIT
Idee und Konzept von Josef Bierbichler
Landestheater NÖ, Großes Haus
Österreich-Premiere
22.11.09, 19. 30 Uhr
Gastspiel – Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin
Uraufführung am 21.06.06
Mit: Josef Bierbichler
Violine: Tina Wainwright
Ausstattung: Mira Voigt
Dramaturgie: Dag Kemser
Licht und Video: Michael Gööck
Dauer: 1 Stunde 20 Minuten, keine Pause
Holzschlachten? Wir kennen Holzfällen von Thomas Bernhard. Wir kennen Sauschlachten von Peter Turrini.
Werke, die sich mit Selektion beschäftigen, die NS-Zeit in die Gegenwart katapultieren. Alleine das Wort Holzschlachten lässt uns ohne Vorkenntnisse des Einakters Böses ahnen. Das wird kein gemütlicher Abend im Theater. Das weiß man. Und trotzdem geht man hin. Will man sehen, so wie nach einem Unfall, wo einer in seiner Blutlache liegt und man sich nicht abwenden kann. Beschämend. Und dann sitzt er da der Josef Bierbichler, entspannt, in seinem Fauteuil auf einem Podesterl und schaut auf das Publikum herab. Da sitzt er als vergreister SS-Arzt Hans Münch, als Forscher an der Menschheit und sinniert über die Vergangenheit. Legt Zeugnis ab, über seine Verbrechen, die doch so vielen das Leben gerettet haben. Wir sprechen über die Medizin, die nicht am heutigen Stand wäre, hätten die Nazischergen nicht an lebenden Menschen experimentiert. Da sitzt er nun und trinkt ein Bier, unverbesserlich, ungebrochen, brüstet sich. Und wir, das Publikum, sitzen da und hören ihm zu. Er spricht vom Alltag in Auschwitz. Vom Foltern als Normalität, vom Töten als Routine, von der Gaskammer als Akt der Menschlichkeit. Nichts Neues, wenn man all die Dokumentarfilme gesehen hat, die Gespräche verfolgt hat mit Zeitzeugen, mit Überlebenden, ob Opfer oder Täter. Da sitzt er da der demente Münch, kämpft gegen Satzausfälle, vernuschelt die Wörter, redet sich in einen Strudel von Widersprüchen, das Langzeitgedächtnis arbeitet besser als das Kurzzeitgedächtnis. Das wahre Erlebte gewinnt gegenüber den Lügen im Auschwitzer-Prozess die Oberhand. Bierbichler ist verschwunden, nicht mehr präsent. Münch sitzt da, kann nur mehr selektieren, kann es nicht lassen. Ein Video zeigt ihn im Wald. Er macht sich an die Arbeit. Münch steht auf, steigt herab von seinem Podest und wählt die Bäume. Fällt sie. Zersägt sie,.zerhackt die Baumstümpfe auf der Bühne, fachgerecht, unermüdlich, mit System. Mit der bloßen Hand. Dazwischen spricht er mit sich selbst oder telefoniert mit Benning, seinem einzigen Kontakt zur Außenwelt. Seinen „Freund“ gegen die Einsamkeit, gegen die Vergessenheit, das einzige Mittel gegen Selbstauflösung. Die Schatten der Vergangenheit haben ihn eingeholt. Bienen schwärmen in seinem Kopf, wie Laute der Sterbenden in den Gaskammern. Die Toten haben Besitz von ihm ergriffen. Er schlichtet das Holz zu einem Scheiterhaufen und legt sich schließlich selbst nackt darauf. Ist Opfer. Einer dieser sechs Millionen Opfer. Einer dieser ausgemergelten verhungerten Figuren, die man in Massengräbern gefunden hat. Der Verbrecher liegt nackt vor uns, ein Mensch, ein Trauerspiel.
1998 führte, wegen seines Portraits des irakischen Terroristen Abu Musab az-Zarqawi (Bruno Schirra: „Der gefährlichste Mann der Welt“, Cicero), der im April 2005 in die Schlagzeilen geratene deutsche Journalist Bruno Schirra ein Interview mit dem 87 jährigen Hans Münch, dem ehemaligen in Auschwitz stationierten deutschen SS-Arzt. Weil er „die Selektion der Juden an der Rampe“ nicht durchführte und sich somit selbst wegen der Gehorsamsverweigerung in Gefahr brachte, wurde er als einziger SS-Arzt im Krakauer Auschwitzprozess freigesprochen. Überlebende des Vernichtungslagers setzten sich für ihn ein, was ihm den Ruf „Der gute Mensch von Auschwitz“ einbrachte. Vor den Gesprächen sah sich Schirra gemeinsam mit dem betagten Münch Spielbergs Film „Schindlers Liste“ an. Das Interview „Die Erinnerung der Täter“ erschien im Der Spiegel Nr. 40, 28. September 1998, S.90–100 und brachte die Justiz wieder in Gange, da sich Münchs Aussagen stark von seinen Darstellungen im Prozess unterschieden. Noch im selben Jahr der Veröffentlichung des Interviews (1998) wurde ein Verfahren gegen ihn wegen Beteiligung an NS-Verbrechen eingeleitet. Wegen seiner Verhandlungsunfähigkeit wurde es später wieder eingestellt. Münch starb 2001. Am 25. Januar 2005 erschien in Die Welt ein irritierender Rückblick auf die Gespräche mit Münch der Jahre 1995-1999. Der mittlerweile 61 jährige Schirra hatte den guten Menschen von Auschwitz endgültig zu Fall gebracht.
Florian List (1944-1990) studierte Germanistik und Geschichte. Der bereits mit 56 Jahren an den Folgen einer Herzoperation verstorbene deutsche Autor hinterließ mehrerer Theaterstücke und Erzählungen, sowie den unvollendeten Roman „Lena“. Die unveröffentlichten, extemporiert in ein Diktiergerät gesprochenen Monologe „Fenster, schwefelgelb“ und „Schwarzer Engel“ wurden nachträglich von seinem Freund, dem Fotografen Kurt Benning transkribiert und in „Holzschlachten. Ein Stück Arbeit.“ verwendet.
Zur Verleihung des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels hielt Martin Walser 1998 eine Rede in der Frankfurter Paulskirche. Die Rede eines Schriftstellers muss irritieren, vielleicht sogar schockieren, meint der 1948 geborene deutsche Theater- und Filmschauspieler Josef Bierbichler. „Wenn geistige Brandstiftung stattgefunden hat, wird sich zeigen, wie gut die Feuerwehr aufgestellt ist. Sollte sie versagen, wissen wir mehr als vorher über unsere Gesellschaft und werden, hoffentlich, entsprechende Schlüsse ziehen. Aber ein Schriftsteller hat nicht den gesellschaftlichen Zustand zu preisen und einen Konsens herzustellen.“ (Josef Bierbichler: Zitat aus dem Programm der Schaubühne am Lehniner Platz 2006).
Es waren wohl die versteinerten facialen Masken der gleichgültigen Korrektheit der bei der Rede anwesenden Politiker und Honoratioren, die Bierbichler Auslöser zu „Holzschlachten“ waren. Diese in sich versunkenen Gesichter, die eindeutig die Monotonie und Schläfrigkeit reflektieren, weil das Thema doch schon zig Mal durchgekaut wurde und uns in eine stoische Gelassenheit versetzen. Wir dämmern dahin. Die in den Alltag übergegangene deutsche NS-Zeit, lieferte Bierbichler die Idee. Und der Begriff der Arbeit. Die damit verbundene Schmach, wenn wir heute munter darauf los sagen: „Ich habe soviel Arbeit.“ Nicht wissend, was Arbeit wirklich ist. Arbeit in Konzentrationslagern. Arbeit, die zum Tode führt.
„Weil sie immer auch den Tod in sich trägt, während sie das Überleben sichert, wohnt der Arbeit auch eine große Wahrheit inne: Der Schmerz. Das Wesen von Geburt, Folter und Tod.“ (Zitat: Josef Bierbichler, aus dem Programm). Die Freiheit, so scheint es in dieser Gesellschaft, kommt erst nach dem Tod und die Nazis haben mit ihrem Propagandaspruch „Arbeit macht frei“ in der Tat ganze Arbeit geleistet. Töten ist Arbeit, Schwerstarbeit. Richtig seelisch und körperlich erschöpft geht man aus dem Theater nach diesem Holzschlachten. Sollte man meinen.
Drei Gespräche mit weiblichen Theaterbesuchern, die am nächsten Tag rein zufällig stattfanden, dokumentieren jedoch den gegenteiligen Effekt. Zu marginal um eine Hypothese aufzustellen, aber allemal eine interessante Beobachtung, die ich niemandem vorenthalten möchte: Die erste ging Heim und putzte ihren Kühlschrank. Die zweite wusch ihre ganze Wohnung auf. Die dritte nahm sich Korrekturen an Schriften vor. Alle drei erledigten am Abend nach dieser Vorstellung für diesen Tag nicht mehr eingeplante Arbeiten. Alles Arbeiten mit Säuberungsmaßnahmen. Eine allzu verständliche menschliche Reaktion, wenn auch unbewusst und nur bei wenigen ausgelöst mit interessanten Aspekten. Vielleicht ist Bierbichlers überwältigendes Gastschauspiel als funktionstüchtige Feuerwehr aufzufassen.