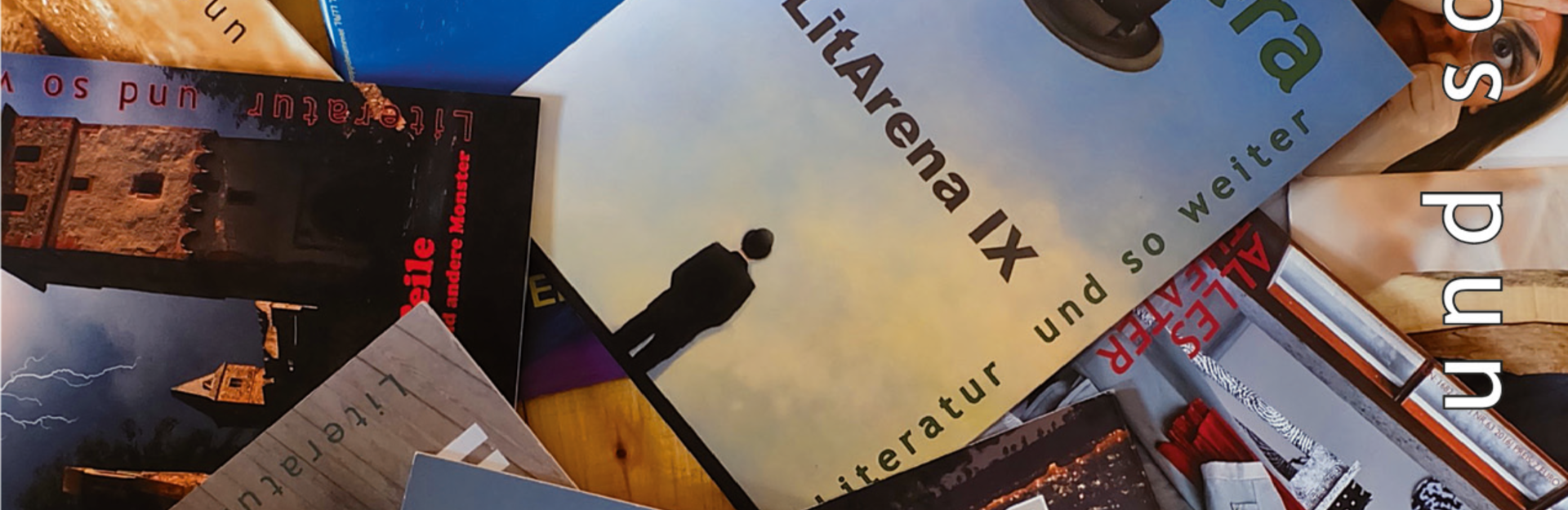14. Philosophicum Lech - 2. Tag: Hans-Hermann Hoppe. Rez.: Ingrid Reichel
Ingrid Reichel
DER STAAT: EIN KONFLIKTERZEUGER, STATT VERMEIDER
STAAT ODER PRIVATRECHTSGESELLSCHAFT?

em o. Univ.-Prof. Dr. Hans-Hermann Hoppe (Uni Nevada, Las Vegas, emeritiert 2008)
24.09.2010, 15.30 Uhr
Neue Kirche, Lech am Arlberg
Für Aufregung sorgte in Lech Hans-Hermann Hoppe, der in Istanbul lebende deutsche, emeritierte Professor für Wirtschaft, Gründer und Präsident der Property and Freedom Society. Moderatorin Elisabeth Nöstlinger stellt ihn als Anarchisten vor, während Konrad Paul Liessmann das Publikum gleich vorweg auf eine Provokation vorbereitete und ihn in einem Radiointerview (Ö1, 29.09.2010, 21 Uhr) als Vertreter eines „militaren Kapitalismus“ bezeichnete. Hoppe nannte den österreichisch-amerikanischen Wirtschafts- und Gesellschaftheoretiker Ludwig von Mises als seinen „persönlichen, intellektuellen Lehrmeister“. Dieser schrieb in seinem Werk „Liberalismus“ (Jena, 1927, online S. 41ff): „Es kann nicht geleugnet werden, daß der Faszismus und alle ähnlichen Diktaturbestrebungen voll von den besten Absichten sind und daß ihr Eingreifen für den Augenblick die europäische Gesittung gerettet hat. Das Verdienst, das sich der Faszismus damit erworben hat, wird in der Geschichte ewig fortleben. Doch die Politik, die im Augenblick Rettung gebracht hat, ist nicht von der Art, daß das dauernde Festhalten an ihr Erfolg versprechen könnte. Der Faszismus war ein Notbehelf des Augenblicks; ihn als mehr anzusehen, wäre ein verhängnisvoller Irrtum.“ (Quelle Wikipedia.)
Hoppe spaltete tatsächlich in kürzerster Zeit die Zuhörer in zwei Lager. Am Abend wurde in der Philosophen Bar im Hotel Krone noch heftig weiter debattiert. Ich persönlich wurde während eines Abendessens im Restaurant Hus Nr. 8 sogar Zeuge eines in Euphorie entstandenen Gedankens einer spontanen Fanclubgründung für Hoppe, während Hoppes Gegner sich nicht unbedeckt hielten, sondern sich schon während der Podiumsdiskussion voll Unmut zu Wort meldeten.
Hoppe beginnt seinen Vortrag mit dem Hinweis, dass Robinson Crusoe wunderbar alleine leben konnte. Erst die Anwesenheit von Freitag brachte Probleme mit sich. Sobald Ressourcenknappheit herrsche, käme es zum Konflikt. In diesem und unserem Schlaraffenland müssten daher Regeln existieren, die ein Zusammenleben ermöglichen. Er, Hans-Hermann Hoppe hätte die Lösung! … Oder zumindest eine Idee: die Idee des Privateigentums. In seinem Schlaraffenland wäre man frei, könne man tun und lassen, was man wolle, wirbt er weiter mit seiner Idee. Doch auch diese Freiheiten hätten Grenzen, denn sie enden dort, wo üblicherweise, die der anderen beginnen.
Vier Regeln listet Hoppe auf:
- Jede Person ist der exklusive Eigentümer ihres physischen Körpers.
- Jede Person ist Privateigentümer der naturgegebenen Güter, die sie zuerst als knapp wahrgenommen hat und selbst zu nutzen und zu bearbeiten begonnen hat.
- Jede Person ist Eigentümer, der von ihr selbst angeeigneten oder selbst hergestellten Güter.
- Güter, die durch gemischte Arbeitsteilung entstanden sind, können nur noch auf dem Weg eines freiwilligen, wechselseitigen, vorteilhaften und konfliktfreien Eigentumstitels übertragen werden.
Der wesentliche Unterschied zwischen Staat und PRG, erklärt Hoppe, liege im Wort: Vertrag.
„Der Staat operiert als ultimativer Rechtsmonopolist in einem vertraglosen rechtlichen Vakuum. Es gibt keinen Vertrag zwischen Staat und Bürger. […]“, meint Hoppe.
Auf ethische und ökonomische Rechtfertigungen dieser Regeln verzichtet Hoppe in diesem Vortrag. Nur solches sei kategorisch festzuhalten: Der Zweck von Normen diene dazu, die ansonsten unvermeidbare Konflikte zu vermeiden. Ein Staat also, der Gesetze aufstellt, die wiederum Konflikte erzeugen, statt sie zu vermeiden, sei eine Perversität.
Die Einsicht (!) in die Alternativlosigkeit der Einrichtung des Privateigentums als Mittel zur Konfliktlösung reiche jedoch nicht aus, soziale Ordnung zu schaffen, so Hoppe. „So lange die Menschen sind, wie sie sind, wird es auch Mörder, Räuber, Diebe und Betrüger geben, die sich nicht an die erläuterten Regeln halten.“, fährt Hoppe fort. Die (einzige) Aufgabe des Staates, Recht und Ordnung durchzusetzen, wäre laut Hoppe nicht nur die vornehmste, sondern gehöre zu den Grundirrtümern des Etatismus, denn er stehe im Widerspruch zu elementaren ethischen und ökonomischen Grundsätzen und Gesetzen. Die Monopolstellung des Staates wäre aus Sicht des Konsumenten „schlecht“ und würde sich mit der Aufgabe der Rechtssicherheit nicht vereinbaren lassen. Diesen Umstand, kritisiert Hoppe, bereite Ökonomen und Philosophen wenig Sorgen. Und wenn, dann würde man das Monopol in Zweifel ziehen, nicht aber die Rechtssicherheit, die doch laut amerikanischer Unabhängigkeitserklärung als Schutz von Leben, Eigentum und dem persönlichen Glücksstreben, vor innerer und äußerer Aggression, d.h. Kriminalität und Krieg zu deuten sei. Da der Staat aber selbst die Konflikte erzeuge und er aber die Letztentscheidungsinstanz habe, wird er zu seinem eigenen Gunsten entscheiden, daran könne weder eine Verfassung noch ein Gericht etwas ändern. Darüber hinaus verfüge der Staat über „territoriale Steuerhoheit“, erläutert Hoppe weiter. Der Staat als „enteigneter Eigentumsschützer“ wäre natürlich interessiert, „die Ausgaben für Sicherheit zu maximieren und gleichzeitig die tatsächliche Produktion von Sicherheit zu minimieren“.
Klar, mit fremdem Geld arbeitet es sich immer sorgloser, als mit dem eigenen Kapital …
Hoppe verweist auf weitere etatistische Grundirrtümer. Die Gleichheit aller vor dem Gesetz wofür man die Monarchie durch die Demokratie ersetze, sei unvereinbar mit der Idee eines „universellen Rechtes“. Denn der einstige Dualismus in der Monarchie (höheres Recht für König und Adel, niederes Recht für die Untertanen) entwickelte sich zu einem Dualismus zwischen öffentlichem Recht und Privatrecht. Statt personeller Privilegien und privilegierter Personen, gäbe es nun funktionelle Privilegien und privilegierte Funktionen.
Hoppe sieht daher die Lösung, wie schon oben angedeutet, in der Privatrechtsgesellschaft (PRG). Die „Produktion von Sicherheit (Recht und Ordnung)“ in einer PRG sieht Hoppe von freifinanzierten, im freien Wettbewerb stehenden Dienstleistungsunternehmen wie „private Polizei-, Versicherungs- und Schlichtungsagenturen“ erledigt, sowie auch die übrigen Güter und Dienstleistungen. Es sei vermessen genaue Prognosen über die Struktur der in einer PRG entstehenden „Sicherheitsindustrie“ (!) erstellen zu wollen, warnt er. Selbstverteidigung wäre in einer PRG unbestritten, spiele im Rahmen einer komplexen, arbeitsteiligen Gesellschaft jedoch eine nebengeordnete Rolle.
Für Hoppe scheint der freie Wettbewerb die Lösung allen Übels zu sein. Er geht in seinen Schilderungen bis hin zur Verfolgung „opferloser Verbrechen“, die da wären: Herstellung oder Konsum illegaler Drogen, Prostitution und Glückspiel. Diese würden in einer PRG auch keine Rolle mehr spielen, da „diese Verbrechen, im Unterschied zu einem echten Verbrechen gegen Person und Eigentum, keinerlei Opfer erzeugen, würde sich niemand finden, der für einen derartigen Schutz mehr Geld auszugeben gewillt ist.“
Bevor sich Hoppe in noch mehr Widersprüche verstricken konnte, frohlockte, der sich bereits in einem System von Frieden, Recht und Rechtssicherheit wiegende Vortragende noch mit der Tendenz einer systematischen „Volksbewaffnung“.
September 2010