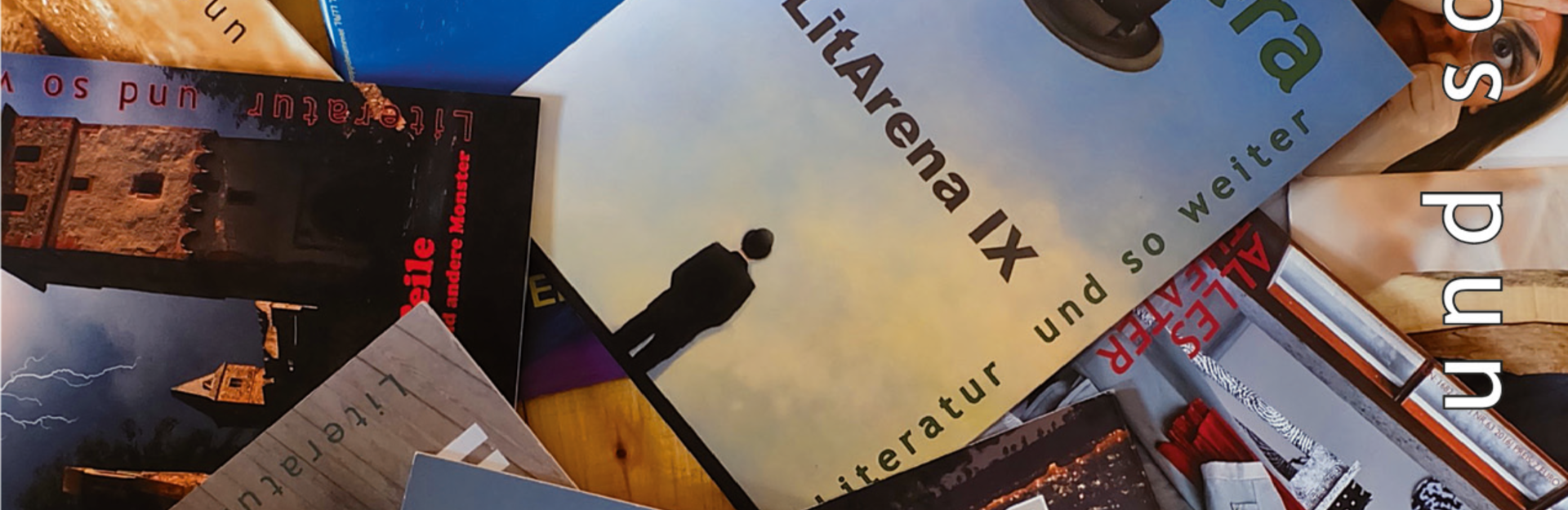Das Käthchen von Heilbronn: Heinrich von Kleist. Rez.: Alois Eder
Alois Eder
VON HEULBRONN NACH GRINSBRONN - STALKING AUF ROMANTISCH
 |
DAS KÄTHCHEN VON HEILBRONN ODER DIE FEUERPROBE
Heinrich von Kleist
Landestheater Niederösterreich
Premiere: 13. 10. 2007
Regie: Johannes Gleim
Dramaturgie: Karoline Exn
Mit Antje Hochholdinger, Christine Jirku,
Karin Yoko Jochum, Charlott von Blumencron
Thomas Mraz, Peter Pikl, Thomas Richter,
Mirko Roggenbock, Philipp Scholze, Helmut Wiesinger
Heulbronn ist jedenfalls wieder in, nachdem Rüdiger Safranski in seiner Romantik-Untersuchung in die Aufmerksamkeit gehoben hat, was sonst die starren Epochen-Schemata der Kulturgeschichte zudecken: Nämlich, dass die Charakterzüge der Romantik, die ihnen anscheinend feindlichen Zeitläufe durchtunneln und etwa im Expressionismus oder bei den 68ern wieder zum Vorschein kommen. So war das ja auch schon mit der Eigenheit der Empfindsamkeit, die Tränen der Ergriffenheit vor der Öffentlichkeit nicht zu verbergen, auch wenn die ihr folgende Aufklärung den Appell an die Instanz der Vernunft höher schätzte...
Ja, wie geht man dann auf heutigen Bühnen mit den Sentimentalitäten von damals um?
Museal verpacktes Kulturgut oder ins Heutige transferierte Inhalte?
Kleists Käthchen von Heilbronn nach heutigem Verständnis als Geschichte einer Stalkerin aufzuziehen, hätte letzteres leicht gemacht, aber so weit wollte das St. Pöltner Landestheater die Modernisierung auch wieder nicht treiben. Man blieb also bei einer Adjustierungserleichterung gegenüber den an sich nötigen mittelalterlichen Kostümen. Ein letzter Rest von Panzerung bleibt dem Erscheinungsbild der Ritter vorbehalten, auch wenn sich Mirko Roggenbock als der angehimmelte Graf Wetter vom Strahl nur in einer Art Freistil-Turnier zu Fuß mit seinen Gegnern herumbalgen muss. Das entspricht einer Reduktion auch im Bühnenbild: für seine Burg genügt eine starre Ziegelmauer, für das Gericht der Expositions-Szene ein Mikrophon, in das die zu verhörenden Kontrahenten sprechen, Helmut Wiesinger als Schmied und besorgter Vater immerhin fast in Berufskleidung, und für Peter Pikls Kaiser des letzten Akts, der sich zu Käthchen als einer unehelichen Tochter bekennen muss, reicht die Aufmachung eines heutigen Premierenbesuchers ...
Aber solche Durchbrechungen der Illusion stören gar nicht, spiegeln sie doch nur wieder, was sich bei der Inszenierung der romantischen Empfindsamkeiten spießt - trotz Safranskis Plädoyers für deren ewige Wiederkehr. Johannes Gleims Regie und Daniela Juckels Ausstattung helfen sich damit, an den ausgefransten Rändern der gefühlstriefenden Szenen den Klamauk anzusiedeln, was vielleicht Kleists Intentionen gar nicht widerspricht, wenn der sich nicht nur den in St. Pölten eher heruntergespielten Blankvers angelacht hat, sondern auch sonstige Shakespeare-Traditionen nach Art des Bedienten als Lustige Figur, selbst wenn’s Johannes Mraz als Gottschalk mit einer auch recht anachronistischen Spielzeug-Selbstmordpistole übertreiben muss, als sein Schwarm Käthchen - Charlott von Blumencron - dann doch noch das Happy End mit seinem Herrn und Ritter geschafft hat.
Ihre Nebenbuhlerin Antje Hochholdinger als Katharina von Thurneck hat den leichteren Part erwählt, die insgeheim schon überwuzelte Intrigantin als standesgemäße Braut muss ja den Empfindsamkeits-Mythos nicht bedienen. Aber insgesamt ist eine homogene Ensembleleistung hervorzuheben, die dem Landestheater zu allen Ehren gereicht, auch wenn es im sonstigen Spielplan immer wieder auch Zuflucht zu TV-mäßig vorbeworbenen Gesichtern nimmt.
Nicht ganz so leicht zu würdigen ist, was die Dramaturgie mit diesem Saison-Erstling bezweckt hat. Ist es nur darum gegangen, eben auch dem Bildungsauftrag nachzukommen, die Klassiker im Gedächtnis zu halten? Oder geht es doch um eine spezielle Affinität Heinrich von Kleists und seines Ritterstücks zu unseren Zeitläuften? Wie das Programmheft dokumentiert, hat schon Zeitgenosse Goethe mit dem Wunderbares Gemisch aus Sinn und Unsinn nichts anfangen können (S. 22), und das Theater an der Wien, das 1810 die Uraufführung gesehen hat, hat schon 1831 Karl Meisl mit einer Parodie als Kathi von Hollabrunn ins Programm genommen (S. 14f.). Also wird man spekulieren dürfen, dass Kleists Ritterstück mit seiner vom Klassiker getadelten verfluchten Unnatur schon damals ein Zugeständnis des Autors an die damalige Ritter-Mode bei den Trivial-Lesestoffen war (S. 21).
Da hätte dann der Inszenierung ein deutlicherer Hinweis auf heutige Mode-Erscheinungen wie die Vorliebe für okkulte Phantastik samt Engels-Magie nicht übel angestanden, was die ohnehin vorgesehene Nebenrolle des Cherubs, der Käthchen etwa beim Brand der Burg zu Hilfe kommt, vielleicht stärker in den Mittelpunkt gerückt hätte. Nach der Art, wie sich solche Moden im Augenblick ihres Auftretens ernst nehmen, wäre dann allerdings die Umwandlung aus einem Heul- in ein Grinsbronn viel mühsamer zu vollziehen gewesen, die dem Ensemble bei der Premiere immerhin einen verdienten Beifallssturm eingetragen hat.