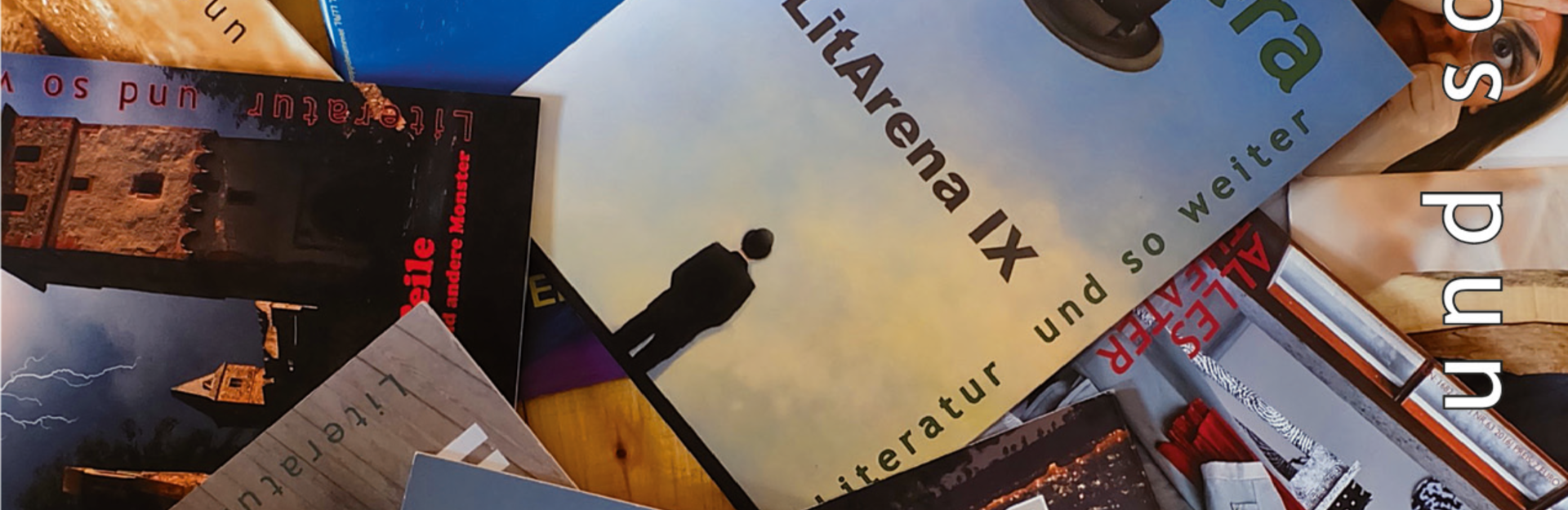Die Eröffnung: Peter Turrini. Rez.: Alois Eder
Johann Heinrich Merck Zwo
GOETHE ZWO IN WEIMAR
 |
DIE ERÖFFNUNG
Peter Turrini
NÖ Landestheater St. Pölten
15.10.05, 16 Uhr
Realität und Bühnenillusion vermischen sich, sagt der Pressetext, in Peter Turrinis virtuosem Monolog, den ihm wohl auch keine ausgebildeter Schauspieler besser nachsprechen könnte, und der schon bei einer Eröffnung des Bochumer Schauspielhauses denselben Dienst getan hat, nämlich Goethes Vorspiel auf dem Theater, das in dieser Rolle schon in Ehren ergraut ist, durch ein vergleichbares Werk eines modernen Klassikers zu ersetzen.
Und mit Erfolg: Ö1-Fans werden einzelne Sätze aus dem Turrini-Monolog aus der bis zur Hypnose wiederholen Eigenwerbung für den ORF-Shop wiedererkennen: Aber auf dem Theater, auf dem Theater fange ich wiederum an: Tja, auch Peter Turrini ist inzwischen in Ehren ergraut, niemand sähe ihm mehr an, dass er mit Rotzznjogd oder Sauschlachten als Stürmer und Dränger begonnen hat - und auch in seiner Biographie hat der Wechsel an den in Aufbau begriffenen Musenhof des Landesfürsten Erwin Pröll das Seine zu dieser Metamorphose beigetragen.
Der hat also diesfalls mit dem Nebeneffekt einer beträchtlichen Verjüngung die Rolle des Weimarer Herzogs Karl August zu spielen, für Heidemarie Onodi fällt bestenfalls die Rolle der Anna Amalia ab, und sogar ein Johann Gottfried Herder als Superintendent und Gegenpol zeigt sich am Horizont: Turrini hat als virtuoser Kardinalsflüsterer auch seinen Duzfreund Schönborn schon mit in seine Ambitionen einbezogen, vom Musensitz St. Pölten aus, das der Dimension nach auch ungefähr hinkommt, den Kulturvulkan zu spielen; die neue künstlerische Leiterin des Landestheaters Isabella Suppanz darf als Frau von Stein dabei assistieren.
Und so gehts: Ein selbsternannter "Theaterkönig" erzählt seine irrwitzige Lebensgeschichte vom Vertreter für Handyfreisprechanlagen zum sterbenden König und greift dabei in die unerschöpfliche Trickkiste des Theaters - auch wenn er bei aller Feudalität von einen kleinwüchsigen und alkoholabhängigen Inspizienten anhängig ist, oder vor lauter Theaterruhm zusehen muss, wie seine Familie den Bach hinabgeht - Höhen und Tiefen halt, über die man im Programmheft gerne hinwegliest.
Sogar an eine namentliche Würdigung der verdienten Souffleuse des Hauses hat der Dichter gedacht, offenbar die eingangs vom größten lebenden österreichischen Dramatiker (Wolfi Bauer ist dem Werbetexter zuliebe offenbar noch gerade rechtzeitig gestorben) erwähnte Anpassung an den jeweiligen Standort. Oder sollte auch die Szene auf dem Bahnhof speziell auf St. Pölten bezogen sein, wo der Handy-Vertreter morgens bei den Pendlermassen kein Gehör findet, aber wenn sich gegen zehn Uhr vormittags die dienstreisenden Intendanten und Dramaturgen die Türen ihrer Erste-Klasse-Abteile in die Hand drücken, auf einmal ein interessiertes Publikum hat, das nur leider sofort abreist, sobald er sich als arbeitsloser Schauspieler outet?
Sollte Turrini sein Stück auch deshalb in persona lesen dürfen, weil das dank des Aufstiegs der Spielstätte verkleinerte Ensemble des ehemaligen Stadttheaters durch derlei nur zu sehr an die vorausgegangenen Turbulenzen erinnert würde? Sogar die Weimar-Analogie lässt sich da weiterspinnen: Wie Goethes Sturm-und-Drang-Kollegen Reinhold Michael Lenz oder Friedrich Maximilian Klinger am Hof des Dichterfürsten keinen Auftrag hatten und fern beim Zaren Dienst suchen mussten, so tritt eben auch Reinhold Hauser als Vorgänger all dieser Herrlichkeit gerade in Amsterdam einen Kulturvermittlerdienst an. Für einen Lenz im überholten Werther-Kostüm hätte nämlich die Frau von Stein bei allem Feinsinn kein Verständnis aufgebracht.
Aber Peter Turrini wird das alles natürlich nicht gemeint haben, auch wenn er sich wie Goethe im Faust trotz des Klassikerstatus gelegentlich heftig bekichert seines seinerzeitigen unflätigeren Wortschatzes bedienen darf: Es ist eben das Kulturpublikum einer Landeshauptstadt, das da sitzt und ihn nicht ohne wiederholte Hervorrufe in sein ländliches Tuskulum zurückfahren lässt.