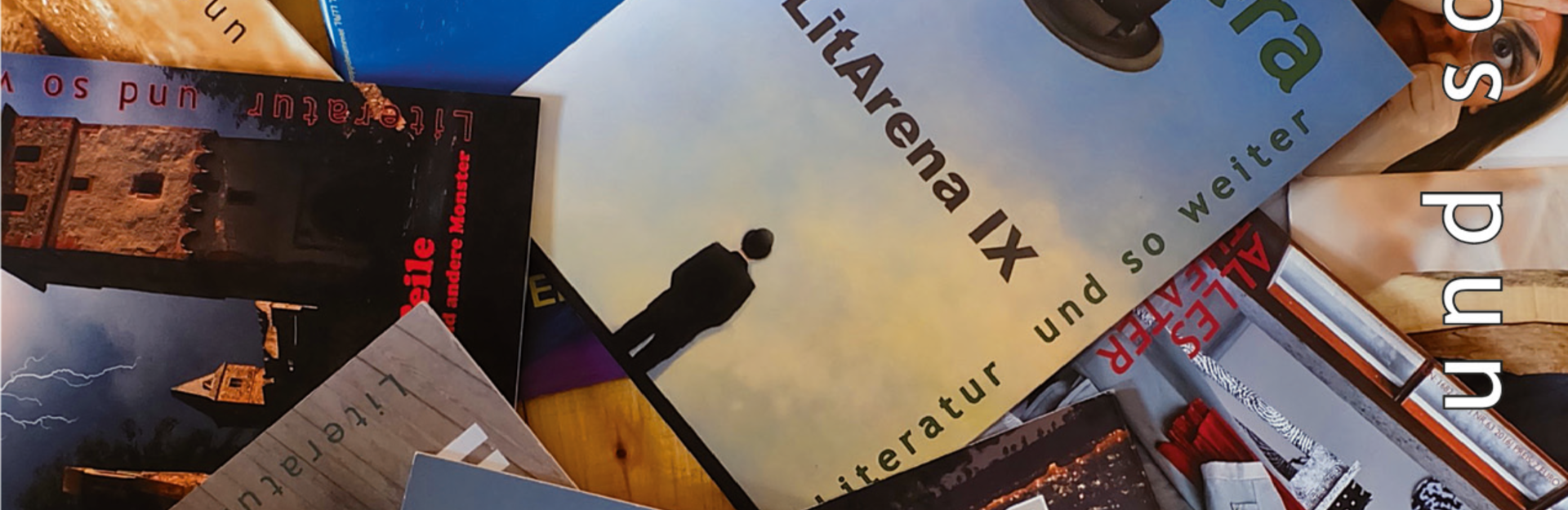Verstörung: Thomas Bernhard. Rez.: Ingrid Reichel
|
Name des Rezensenten
Thomas Bernhard Bearbeitung: Karl Baratta und Gwendolyne Melchinger Landestheater NÖ, Großes Haus 04.12.2010, 19.30 Uhr Regie: Karl Baratta Bühne und Kostüme: Daniela Juckel Mit: Christine Jirku, Brigitte Karner, Katharina von Harsdorf, Hans Hollmann, Benjamin McQuade, Oliver Rosskopf, Helmut Wiesinger, Paul Wolff-Plottegg Dauer: 2 Std. 30 Min. inkl. Pause nach 50 Min. Uraufführung
|
Bereits 1967 erschien „Verstörung“ von Thomas Bernhard im Suhrkamp Verlag. Nach „Frost“ (1964) war es sein zweiter Roman. Im Auftrag des Landestheaters NÖ schrieb der in Wien geborene Regisseur und Dramaturg Karl Baratta gemeinsam mit der Dramaturgin Gwendolyne Melchinger das Prosawerk zu einem Theaterstück in zwei Akten um.
Und so haben wir es wieder einmal mit einer Rarität im Landestheater NÖ zu tun: mit einer Uraufführung eines Werkes von Thomas Bernhard.
Bernhard, das deklarierte enfant terrible der österreichischen Literaturszene, hatte seine eigene 68-er Revolution gemacht. In der Verkörperung eines Studenten, der seinen Vater, einen Landarzt in der Steiermark bei einem langen Tag der Visite begleitet, die auf der Burg Hochgobernitz bei seinem Patienten den Fürsten Saurau endet, lässt Bernhard die österreichische Nachkriegsszenerie Revue passieren. Es sind die Reflexionen des Studenten über die Aussagen des Landarztes und die Selbstgespräche des Fürsten, die der Gesellschaft den Spiegel vorsetzen.
So reflektiert der Student die Gedankengänge seines Vaters: „Es sei für mich eine fortgesetzte Traurigkeit, wenn ich ihn begleite, und aus diesem Grund zögere er auch die meiste Zeit, mich auf seine Krankenbesuche mitzunehmen, weil sich immer in allen Fällen zeige, dass alles, was er aufsuchen und anrühren und behandeln müsse, sich als krank und traurig erweise; gleich, um was es sich handle, bewege er sich fortwährend in einer kranken Welt unter kranken Menschen, Individuen; auch wenn diese vorgebe, vortäusche, eine gesunde zu sein, sei sie doch immer eine kranke und die Menschen, Individuen, auch die sogenannten gesunden, immer krank.“ (Suhrkamp Tb: S. 14).
Dabei steht nicht nur die andauernde Volksdepression im Vordergrund, auch die familiäre Beziehung des Landarztes mit seinem Sohn und seiner Tochter sind Thema. Bernhard dringt bis in die kleinsten Ritzen unserer Seele. Ein Brief des Sohnes an seinen Vater verdeutlicht die chaotischen zwischenmenschlichen Beziehungen. „Es war mir immer unmöglich gewesen, ihn (den Brief) zu schreiben. Die Peinlichkeit, in einem solchen Brief auf einmal auszusprechen, was jahrelang nur gedacht worden ist, Vermutungen zur Sprache zu bringen, war mir jedes Mal sofort bewusst. Auch die Scheu, möglicherweise längst vergessenes Material für die in diesem Brief unerlässlichen Beweise meiner Anschauung von uns heranziehen zu müssen, vereitelte mein Vorhaben. Ich musste ja aufrichtig und also rücksichtslos und doch auf alle Betroffenen Acht gebend vorgehen, das machte einen solchen Brief so lange Zeit unmöglich.“ (S. 23).
Auf Burg Hochgobernitz spitzt sich die Lage dann zu. Fürst Saurau schwelgt einerseits in der Erinnerung der guten kaiserlichen Zeit. Die einstigen Naturkatastrophen wie Hochwasser und Murenabgänge vermengen sich mit den „Saurauschen Schauspielen“, die in seinem Lusthaus aufgeführt wurden, zu einem monumentalen Schauspiel. Bibliotheken, in denen nicht mehr gelesen wird, außer alte Zeitungen aus der guten alten Zeit, Räume mit Wänden, die keine Gemälde mehr tragen, frauenfeindliche Sprüche, die das Patriarchat mit all seinen Machtansprüchen zurückerobern wollen, zeigen die Rückseite der Medaille: die Lächerlichkeit einer veralteten, unappetitlich gewordenen, alleingelassenen und vereinsamten Gesellschaft.
„Alles immer verändern zu wollen, das ist mir ein ständiges Bedürfnis, eine infame Lust, die zu den peinlichsten Zerwürfnissen führt. Die Katastrophe fängt damit an, dass man aus dem Bett steigt. Dass man alles auf ein philosophisches Fundament stellt, sich produziert. Die Finsternis ist kalt, wenn der Kopf ausgeschaltet ist.“ (Fürst Saurau, S. 203))
Karl Baratta geht mit der komplexen Sprache und den permanenten Wiederholungen Bernhards subtil ans Werk. Wie ein Mann am Mischpult lässt er die einzelnen Stimmen der Schauspieler ineinander gleiten, mixt sie zu einem Sprachchor, verstärkt massiv Bernhards Intentionen, oft bleiben nur Schlagwörter wie „Opfer“ hörbar. Die Gleichzeitigkeit der Gespräche und der Gedanken hämmern sich in die Gehirne der Theaterbesucher.
„Es ist ein unheimliches Buch, das wie eine klassische Erzählung anfängt und den Leser ins Grauen hineintreibt, ohne dass er es merkt.“, sagt Thomas Bernhard über sein eigenes Werk „Verstörung“.
Dies ist Baratta und Melchinger mit ihrer dramaturgischen Umsetzung auch meisterhaft gelungen. Gesteigert wird die Inszenierung noch durch das minimalistische Bühnenbild und den fahrbaren Sesseln und Tischen. Daniela Juckel führt nach ihrer Szenographie in Hjalmar Söderbergs Dreiakter „Gertrud“ im Landestheater NÖ, welcher im Mai 2011 noch zweimal aufgeführt wird, ihre Taktik der nackten Räumlichkeit und der beweglichen Requisiten weiter. Kein Gegenstand zuviel kann uns von dieser mächtigen Bernhardschen Sprache ablenken. Schlichte helle, zerschlissene blau-graue Wände geben die undefinierte Räumlichkeit der verschiedenen Szenen wieder, Details erübrigen sich, erledigt der Zuschauer in seiner Fantasie, falls er überhaupt Zeit dazu hat, aufgesogen von der schauspielerischen Leistung dieses so komplexen Stückes.
Der bekannte Theaterregisseur und Schauspieler Hans Hollmann ist auf der Landestheaterbühne erstmals zu sehen. Er spielt die Rolle des Fürsten Saurau und kommt demzufolge erst im zweiten Akt zum Einsatz. Seine Mimik ist nicht zu toppen. Besser kann man sich nicht vorstellen den Fürsten zu spielen: seine Vergesslichkeit, seine Überheblichkeit, seine Eitelkeit, seine Menschlichkeit … Das ehemalige Ensemblemitglied des Burgtheaters Paul Wolff-Plottegg spielt nicht weniger überzeugend den akademisch gebildeten, engagierten Landarzt. Die allseits beliebte Theater-, Film- und Fernsehschauspielerin Brigitte Karner spielt natürlich und sinnlich gleich drei Rollen, jeweils die Schwester des Fürsten, die des Patienten Krainer und die Halbschwester des Industriellen. Vom NÖ Theaterensemble spielt Oliver Rosskopf, den verklemmten Studenten und Sohn des Arztes. Zusätzlich zu den schwierigen Texten nimmt er bravourös auch körperliche Anstrengung auf sich. Ebenfalls vom NÖ Ensemble spielen Katharina von Harsdorf zwei Rollen, einerseits die Tochter, andererseits den Sohn des Fürsten Saurau, Christine Jirku die tote Wirtsfrau, die Patientin Ebenhöh und die Dienerin des Fürsten, Helmut Wiesinger den Industriellen, Lehrer und für den Job des Forstverwalters sich meldenden Zehetmayer. Der Amerikaner Benjamin McQuaid spielt den jungen geisteskranken Krainer und sorgt für die musikalische Begleitung am Klavier.
In einer Zeit, in der sich der Rechtsradikalismus europaweit ausdehnt, und vor allem in Österreich, wo man noch immer fleißig Unangenehmes unter dem Teppich kehren möchte, kann Bernhard nicht oft genug gespielt aber vor allem mit solch einer Glanzleistung von Inszenierung und schauspielerischer Fähigkeit nicht oft genug gesehen werden. Bravo!